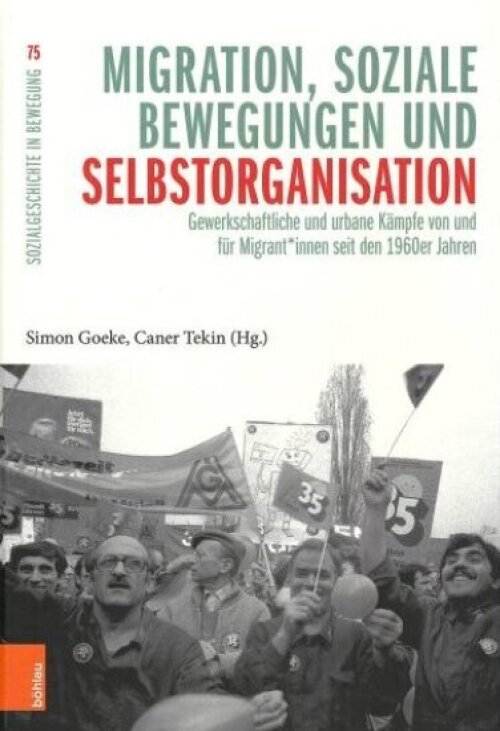
Simon Goeke/ Caner Tekin (Hg.) 2025
Migration, soziale Bewegungen und Selbstorganisation
Gewerkschaftliche und urbane Kämpfe von und für Migrant*innen seit den 1960er Jahren.
Band 75
Migration ist ein wesentlicher Motor sozialen Wandels. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Einwanderungsgesellschaften Europas von einer Vielzahl kultureller und sozialer Bewegungen geprägt, die von Migrant:innen initiiert oder getragen waren. Mit informellen Netzwerken, Basisinitiativen, Bündnissen und Selbstorganisationen kämpften Migrant:innen gegen soziale Ungleichheit und rassistische Diskriminierungen sowie für ihre Anerkennung und ein Bleiberecht. Dieser Band bietet einen umfassenden Einblick in diese Geschichte der migrantischen Selbstorganisation in West- und Ostdeutschland sowie in Belgien. In zehn Beiträgen untersuchen Historiker:innen, Soziolog:innen und Gewerkschafter:innen die Strategien und institutionellen Entwicklungen von migrantischen Selbstorganisationen in ihrer Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Akteuren. Dabei steht insbesondere die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und urbanen sozialen Bewegungen im Fokus. Die Lokalstudien beziehen sowohl Quellen etablierter Archive als auch Überlieferungen der sozialen Bewegungen und Selbstorganisationen ein und betonen die Bedeutung der migrantischen Kämpfe für die Sozialgeschichte Deutschlands und Belgiens. Der Band ist in Kooperation mit dem Münchner Stadtmuseum entstanden.
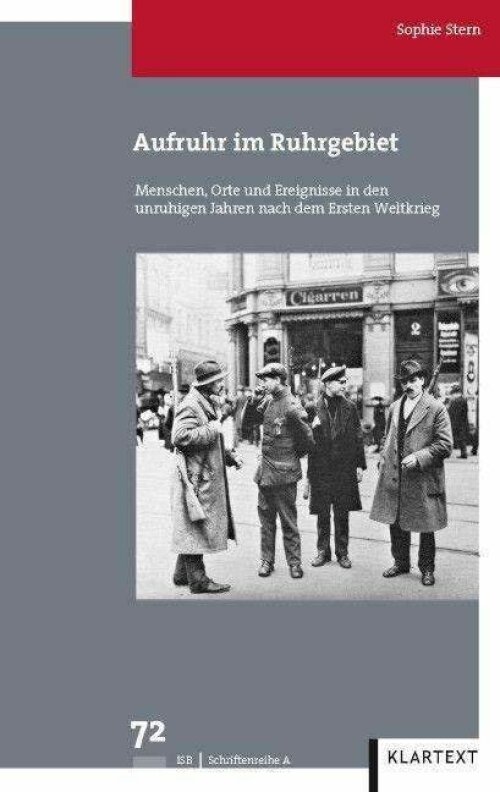
Sophie Stern 2023
Aufruhr im Ruhrgebiet
Menschen, Orte und Ereignisse in den unruhigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
Band 72
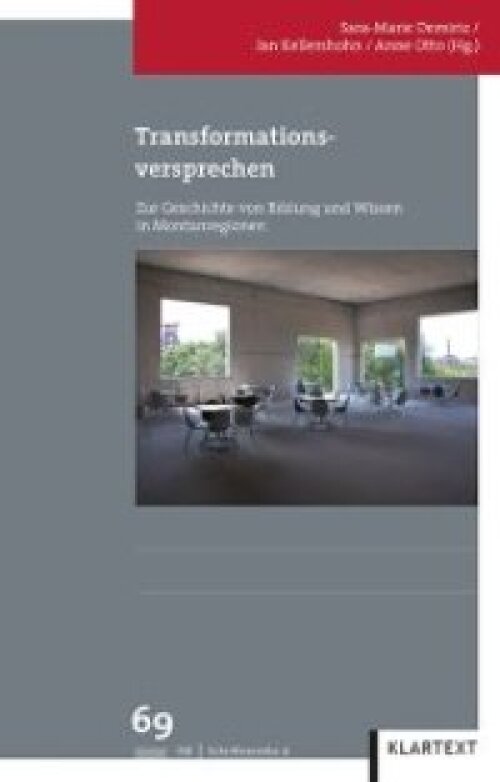
Jan Kellershohn, Sara-Marie Demiriz, Anne Otto (Hg.) 2021
Transformationsversprechen
Zur Geschichte von Bildung und Wissen in Montanregionen
Band 69
Bildung und Wissen gelten als Ressourcen dafür, vermeintlich „bildungsferne“ ehemalige Industriegebiete in zukunftsfähige „Wissensmetropolen“ zu transformieren. Die in dem Band versammelten Beiträge unterziehen dieses Transformationsversprechen einer historischen Analyse: Dabei wird zum einen deutlich, dass Montanregionen auf eigene Bildungstraditionen zurückblicken können. Bildung und Wissen gab es in schwerindustriellen Ballungsräumen bereits vor dem „Strukturwandel“, dem Ausbau höherer Bildungseinrichtungen und der Ansiedlung wissenschaftlicher Institute. Zum anderen zeigen die Autor*innen, dass die strahlende Zukunft der Wissensregionen ihre Schattenseiten hat. Die mit dem Transformationsversprechen verbundenen Maßnahmen und (Bildungs-)Reformen waren und sind auch eine Herrschaftstechnik. Sie schufen Zukunft, zogen dabei aber neue Ausschlüsse nach sich und konfrontierten Individuen mit ihrer Entmachtung. Die historische Perspektive beleuchtet die Wirkungsmacht und Fragilität dieses Versprechens und mahnt, die ihm inhärenten Ambivalenzen auch in der Gegenwart zu reflektieren.

Diana Wendland 2021
Alternative Reiseführer
Entstehung, Verbreitung und Professionalisierung von den 1970er bis zu den 1990er Jahren
Band 66
Seit seiner Entstehung wurde Tourismus durch Medien begleitet, reflektiert, vorangetrieben und konstruiert. Besondere Bedeutung kommt im Wechselspiel aus Tourismus und medialer Darstellung dem Reiseführer zu, der touristische Praktiken als ältestes touristisches Medium seit dem Bürgertum begleitet. Diese Studie untersucht die bislang kaum beleuchtete Genese des in den 1970er Jahren im linksalternativen Milieu aufkommenden alternativen Reiseführers als Bestandteil der Geschichte des Tourismus und seiner Medien nach 1945. Im Vordergrund der Analyse stehen die Konstruktion einer alternativtouristischen Reisepraxis durch alternative mediale Formate, Visualisierungen und Narrationen, Veränderungen des Mediums Reiseführer selbst sowie Wechselwirkungen zwischen Tourismusentwicklung und medialer Reflexion.
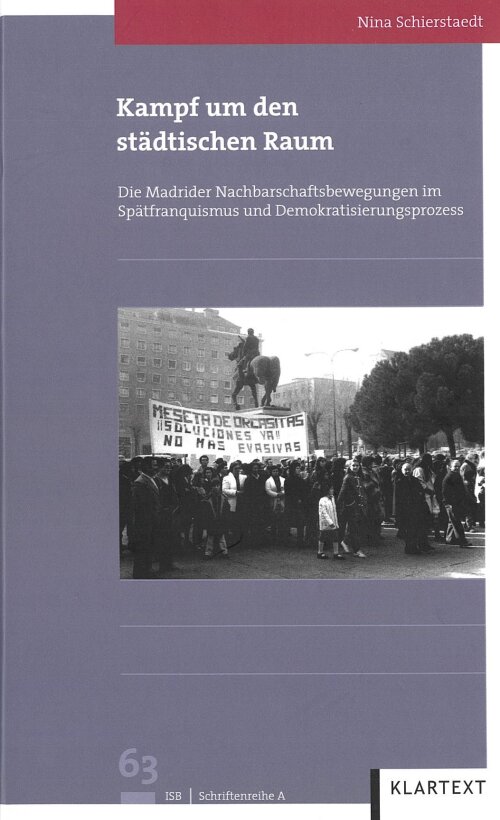
Nina Schierstädt 2017
Kampf um den städtischen Raum
Die Madrider Nachbarschaftsbewegungen im Spätfranquismus und Demokratisierungsprozess
Band 63
Während der späten Franco-Diktatur entwickelten sich die Quartiere der spanischen Hauptstadt zu Arenen der Konfrontation sozialer Interessen. Nachbarschaftsvereine attackierten die gängige Praxis der Stadtentwicklung und mobilisierten die Bewohner für die Durchsetzung städtebaulicher Alternativen. Anhand von mikrohistorischen Fallstudien zu vier Quartieren der Madrider Peripherie analysiert die Autorin die Wechselwirkungen und Wechselbezüge zwischen dem Auftreten der Nachbarschaftsbewegungen und dem Wandel des städtischen Raums. Sie zeigt, wie es den urbanen Unter- und Mittelschichten gelang, ihre Forderungen mittels eines zunehmend differenzierten Handlungsrepertoires durchzusetzen und aktiv an der Gestaltung ihrer Stadtviertel mitzuwirken.
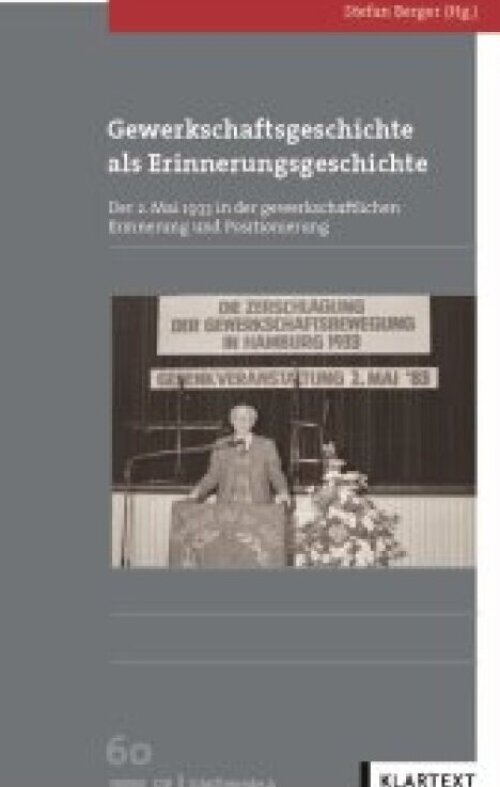
Stefan Berger (Hg.) 2015
Gewerkschaftsgeschichte als Erinnerungsgeschichte
Der 2. Mai 1933 in der gewerkschaftlichen Erinnerung und Positionierung
Band 60
Am 2. Mai 1933 lösten die Nationalsozialisten die Freien Gewerkschaften auf. Die Gewerkschaftshäuser wurden besetzt, das Gewerkschaftsvermögen beschlagnahmt und führende Gewerkschaftsfunktionäre verhaftet. Diesem Tag vorausgegangen war, ein bis nahe an die Selbstaufgabe gehender Anpassungsprozess, durch den die Gewerkschaftsführung die Organisation in den „neuen“ Staat hinüberretten wollte. Die 20 Beiträge des Bandes beschäftigen sich damit, wie sich Gewerkschaften und Gewerkschafter im Exil und nach 1945 an die Geschehnisse von 1933 und die folgende nationalsozialistische Zeit erinnerten, wie sich diese Erinnerungen veränderten und welche Lehren aus den Erinnerungen gezogen wurden.
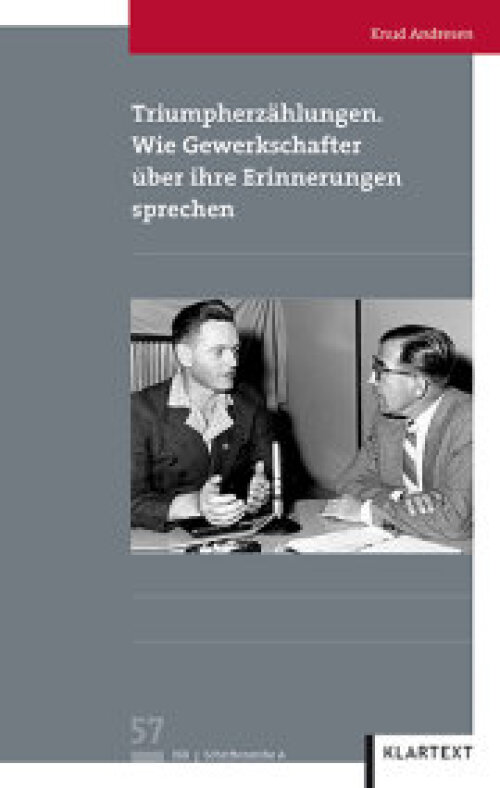
Knud Andresen 2014
Triumph- erzählungen
Wie Gewerkschafter über ihre Erinnerungen sprechen
Band 57
Einen „sozialen Wandel von revolutionärer Qualität“ nehmen Historiker heute für die 1970er Jahre an. Damit ergibt sich eine sozialgeschichtliche Zäsur innerhalb der sonst vergleichsweise bruchlosen Geschichte der Bundesrepublik. Das vorliegende Buch ist dem Widerhall dieses „Strukturbruchs“ in den Erfahrungen von Betriebsräten und Gewerkschaftern auf der Spur. Auf der Basis von lebensgeschichtlichen Interviews mit Angehörigen der Basiselite, die nicht nur Zeugen des Wandels waren, sondern diesen vor Ort mitgestaltet haben, verfolgt der Autor durch Analyse ihrer Erzählmuster die retrospektive Konstituierung der Epoche mit einem auffallenden Befund: Trotz krisenhafter Erfahrungen bilden Triumphe ein wichtiges Erzählmuster der Akteure.
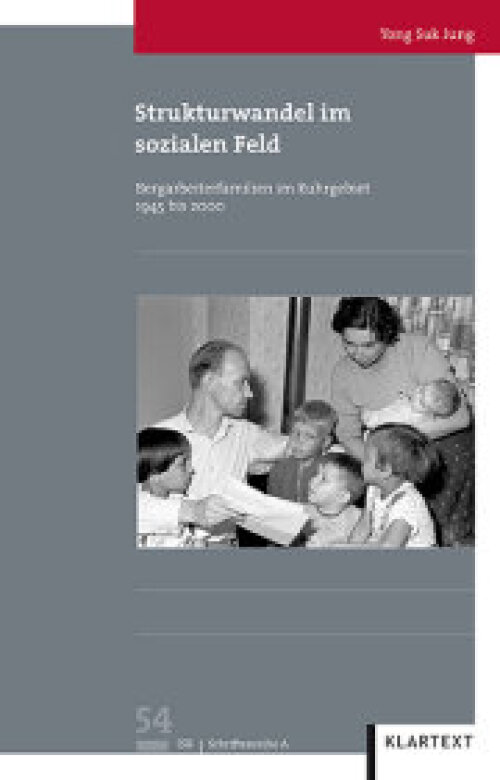
Yong Suk Jung 2015
Strukturwandel im sozialen Feld
Bergarbeiterfamilien im Ruhrgebiet, 1945-2000
Band 54
Der Strukturwandel im Ruhrgebiet ist bisher vor allem als ökonomisch beeinflusster Prozess begriffen worden. Dagegen sind seine sozialen Aspekte noch kaum untersucht. Diesem Strukturwandel im sozialen Feld wendet sich das Buch von Yong Suk Jung zu, indem es den nach Ende des Zweiten Weltkrieges einsetzenden Wandel der Familienbildung im Ruhrgebiet bis in die jüngste Vergangenheit verfolgt. Ausgehend von den durch den Krieg verursachten Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur des Ruhrgebiets untersucht das Buch unter anderem die Auswirkungen der Wohnungssituation von Bergarbeitern auf deren Familienplanung und diskutiert, welche Folgen die zunehmenden Erwerbsmöglichkeiten für Frauen auf die Familienbildung hatten.
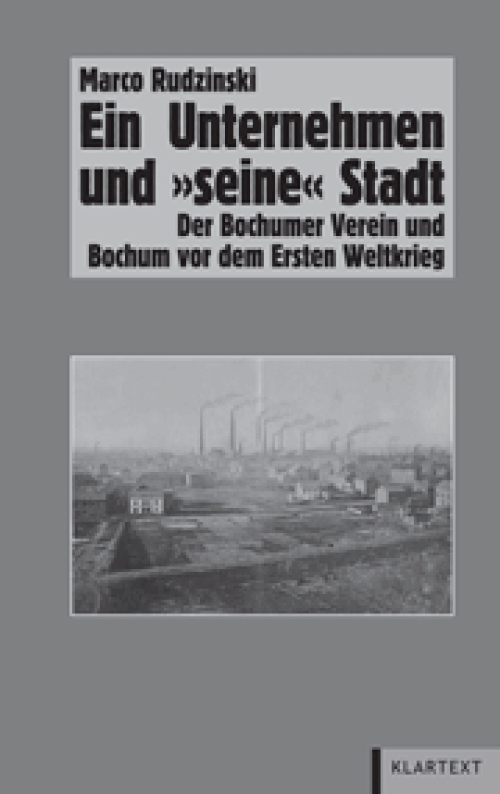
Marco Rudzinski 2012
Ein Unternehmen und "seine" Stadt
Der Bochumer Verein und Bochum vor dem Ersten Weltkrieg
Band 51
Die Ansiedlung und Entwicklung von Großunternehmen prägen Erscheinungsbild und Strukturen ihrer unmittelbaren Umgebung. Die im 19. Jahrhundert im Ruhrgebiet entstehenden schwerindustriellen Unternehmen wie der Bochumer Verein wirkten auf ihr Umfeld sogar geradezu überformend. Sie ließen Städte und Gemeinden anwachsen und erst zu Industriestandorten werden. Die Bedeutung der großen schwerindustriellen Unternehmen für das Werden der Montanregion und das explosionsartige Wachstum von Städten in der Industrialisierungsphase sind zwar gut bekannt. Indes sind die Beziehungen zwischen den Unternehmen und den von ihnen dominierten Gemeinwesen noch kaum
untersucht. Das Buch analysiert anhand der Kategorien Raum, Politik und Gesellschaft das Verhältnis des Bochumer Vereins zu der sich zur Großstadt entfaltenden Industriestadt Bochum. Es leistet damit sowohl einen wichtigen Beitrag zu einem vernachlässigten Feld der Unternehmensgeschichte als auch zur regionalen Urbanisierungsgeschichte.
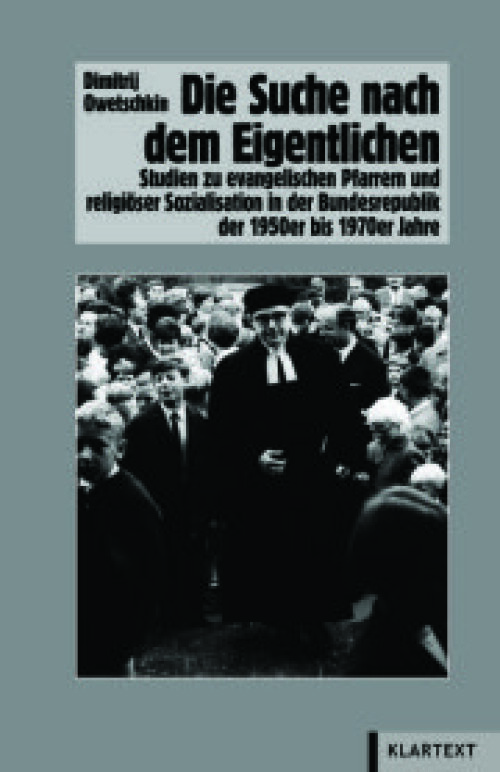
Dimitrij Owetschkin 2011
Die Suche nach dem Eigentlichen
Studien zu evangelischen Pfarrern und religiöser Sozialisation in der Bundesrepublik der 1950er bis1970er Jahre
Band 48
Als Repräsentanten und Personifikationen der Kirche spielten evangelische Pfarrer eine maßgebliche Rolle bei der religiös-kirchlichen Sozialisation. Nach 1945 wurden sie unter den Bedingungen der Demokratie und der Partnerschaft von Staat und Kirche mit dem Rückgang der traditionellen Kirchenbindung, öffentlichen Auseinandersetzungen um kirchenpolitische und theologische Fragen sowie mit Tradierungsproblemen religiös-kirchlicher Normen, Werte, Deutungen und Verhaltensweisen konfrontiert. Wie die Pfarrer auf diese Herausforderungen reagierten und welche Bedeutung dabei ihren eigenen Sozialisationserfahrungen zukam, wird in dem Band anhand des pastoralen Handelns in einzelnen Feldern der Gemeindearbeit untersucht. Dabei werden auch sozialisatorische Prägungen unterschiedlicher Pfarrergenerationen eingehend analysiert. Besonderes Augenmerk gilt dem Wandel der Pfarrerrolle und des Pfarrerbildes, in dem sich Relevanzverschiebungen im sozialisatorischen Wirken der Pfarrer widerspiegelten.
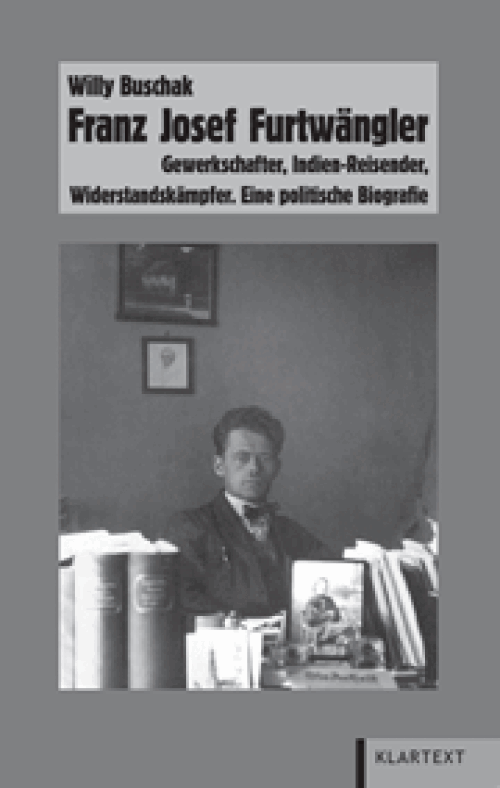
Willy Buschak 2010
Franz Josef Furtwängler (1894–1965)
Band 45
Franz Josef Furtwängler ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Weimarer Republik. Als Gewerkschafter reiste er 1925/26 durch Indien. Ganz anders als die Europäer seiner Zeit sah er den Orient mit dessen eigenen Augen und prophezeite
schon in den 1920er Jahren den Aufstieg Indiens zur Industriemacht. Gegen Ende der Weimarer Republik knüpfte er Kontakte zur NSDAP. Zeitgenossen und Historiker verdächtigten ihn sogar, im Auftrag der Gewerkschaften mit der NSDAP-Größe
Gregor Straßer verhandelt zu haben. Um sich in Sicherheit zu bringen, ging er 1934 ins Exil nach Ungarn, wurde vier Jahre später nach Deutschland ausgewiesen und landete – im Auswärtigen Amt, im Sonderreferat Indien. Furtwänglers wichtige Rolle im deutschen Widerstand ist heute völlig unbekannt: Er war einer der wichtigsten Mitarbeiter von Adam von Trott zu Solz, hielt enge Verbindung zum Kreisauer Kreis und war das Scharnier zwischen bürgerlichem und gewerkschaftlichen Widerstand. Unter abenteuerlichen Umstand konnte er in der Endphase des Zweiten Weltkrieges überleben. Als hessischer Landtagsabgeordneter und Publizist kämpfte er für eine demokratische Entwicklung Deutschlands.

Karl Christian Führer 2009
Carl Legien (1861-1920)
Gewerkschaftsarbeit für ein "möglichst gutes Leben" der Arbeiter
Band 42
Die berufliche Karriere von Carl Legien (1861-1920) reicht vom Drechslergesellen bis zum wichtigsten Gewerkschaftsführer des Kaiserreichs. In den Jahren von 1890 bis zu seinem Tod prägte er als „Generalissimus“ der sozialdemokratischen Arbeiterverbände deren Politik und Selbstverständnis. Das Buch erzählt sein Leben und zeigt Legien als einen widersprüchlichen Charakter: Hart gegen sich selbst und gegen die Menschen um ihn herum, kämpfte er unermüdlich für ein besseres Leben der Arbeiter, ohne selbst Freude am Leben zu haben. So entsteht erstmals ein genaues Porträt dieses wichtigen Mannes, der politisch äußerst erfolgreich war, persönlich aber unglücklich blieb.
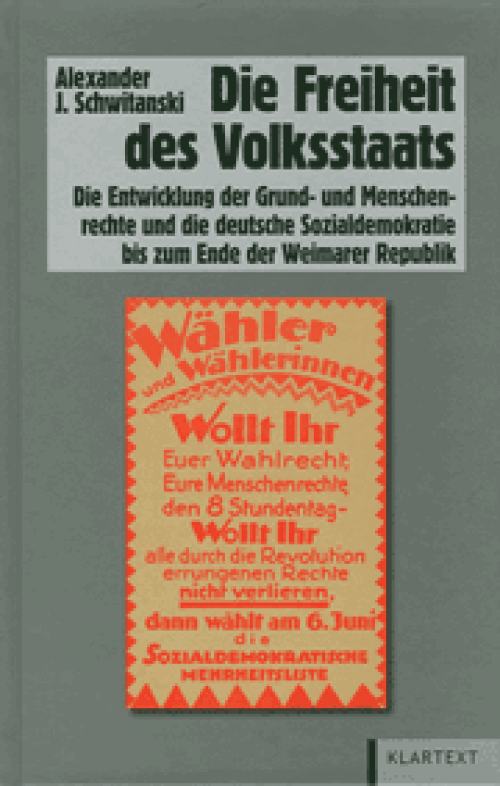
Alexander Schwitanski (Hg.) 2008
Die Freiheit des Volksstaats
Die Entwicklung der Grund- und Menschenrechte und die deutsche Sozialdemokratie bis zum Ende der Weimarer Republik
Band 39
Die Geschichte der Weimarer Republik ist auch eine Geschichte der Freiheit in Deutschland. Bislang ist diese Geschichte allerdings vor allem in Bezug auf das Regierungssystem der Weimarer Republik beantwortet worden, weniger in Bezug auf die persönliche Freiheit des Bürgers. Anhand der heute für das Freiheitsverständnis so zentralen Kategorien der Grund- und Menschenrechte untersucht Alexander Schwitanski, welche Vorstellungen von der rechtlichen Sicherung der persönlichen Freiheit Sozialdemokraten in der Weimarer Republik entwickelten. Dazu bezieht Schwitanski ideengeschichtliche, soziale, politische und rechtsgeschichtliche Faktoren aufeinander, um in einem differenzierten Ansatz die Entwicklung der Grund- und Menschenrechte im Verständnis der Sozialdemokratie als Teil einer spezifischen Auffassung von Freiheit in der Weimarer Republik zu beschreiben.
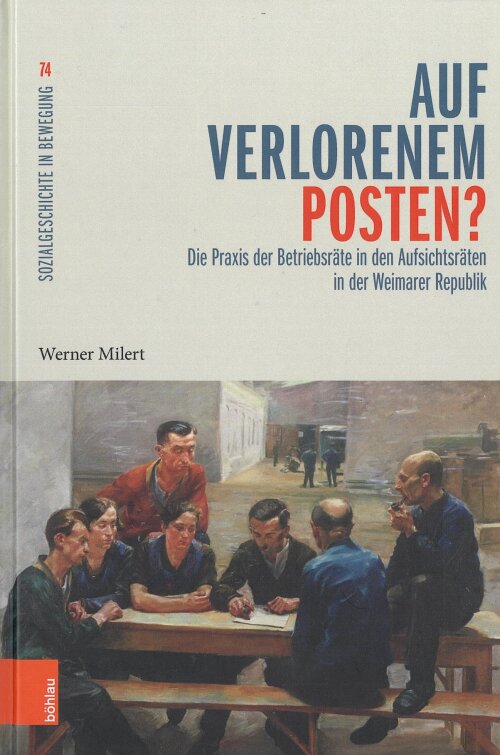
Werner Milert (2024)
Auf verlorenem Posten?
Die Praxis der Betriebsräte in den Aufsichtsräten in der Weimarer Republik
Band 74
Das „Gesetz über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat“ vom 15.2.1922 ist die Geburtsstunde der Unternehmensmitbestimmung in Deutschland. Erstmals wurde die institutionelle Berufung von maximal zwei Arbeitnehmervertretern in die unternehmerischen Kontrollorgane rechtlich fixiert. In der Praxis stieß diese erste gesetzliche Fixierung der Unternehmensmitbestimmung in der Weimarer Republik jedoch in vielen Unternehmen auf erbitterten Widerstand. Insbesondere die Schwerindustrie verharrte in einer Kooperationsunwilligkeit gegenüber den Interessenvertretungen; die Betriebsräte wurden in den Aufsichtsräten von wichtigen Informationen und Entscheidungen ausgeschlossen und zu Aufsichtsratsmitgliedern zweiter Klasse degradiert. Dagegen arrangierten sich die Arbeitgeber der „neuen“ Industrien, insbesondere der chemischen und elektrotechnischen, mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen, die der Weimarer Staat gesetzt hatte.
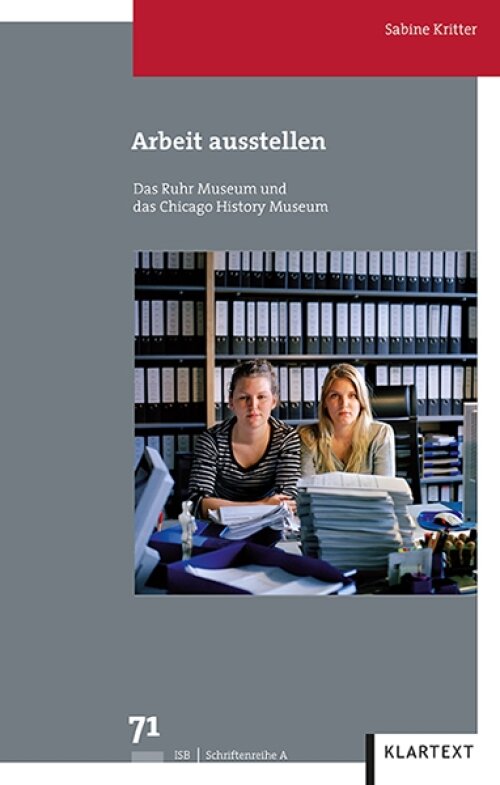
Sabine Kritter 2022
Arbeit ausstellen
Das Ruhr Museum und das Chicago History Museum
Band 71
Angesichts des rasanten Wandels der Arbeitswelt boomt die Diskussion um die Gegenwart und Zukunft der Arbeit. Auch Museen wirken mit ihren Ausstellungen an einer Neubestimmung von Arbeit mit.
Anhand von zwei Stadt- und Regionalmuseen analysiert Sabine Kritter, welche Vorstellungen von historischer und aktueller Arbeit Museen in altindustriellen Regionen in Deutschland und den USA derzeit produzieren. Sie zeigt, welche Rolle museumskulturelle Kontexte spielen und wie das tendenzielle Verschwinden gegenwärtiger Arbeit aus den Ausstellungen mit der Imaginationskrise der Arbeit und mit regionalen Identitätskonzepten im Zusammenhang steht.
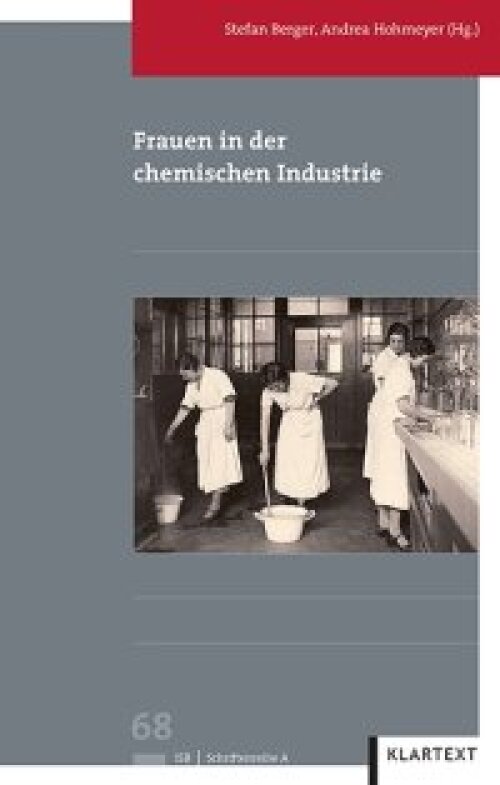
Stefan Berger, Andrea Hohmeyer (Hg.) 2021
Frauen in der chemischen Industrie
Band 68
Frauengeschichte meets Industrie- und Unternehmensgeschichte: Die hier vorgelegten Beiträge gingen aus einer Kooperation der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets mit dem Konzernarchiv der Evonik Industries AG hervor. Sie reflektieren die Entwicklung der Stellung von Frauen in der chemischen Industrie vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Im Hinblick auf weibliche Beschäftigung bei den Vorgängergesellschaften von Evonik spannt sich ein weiter Bogen von den Laborangestellten zur Zeit des Ersten Weltkriegs über Chemikerinnen, die lange Jahre als „Raritäten“ galten, bis zu den Arbeitsumständen von Zwangsarbeiterinnen im „Dritten Reich“. Einen Kontrast dazu bilden die Darstellungen der „Anilinerinnen“ bei BASF, wie auch der frühen Managerinnen des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche. Auch der aktuellen Situation von Frauen in der deutschen chemischen Industrie ist ein Aufsatz gewidmet, während sich drei weitere Beiträge dieses Sammelbandes mit der gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen in Frankreich vor 1914 sowie in Deutschland und den USA nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen.
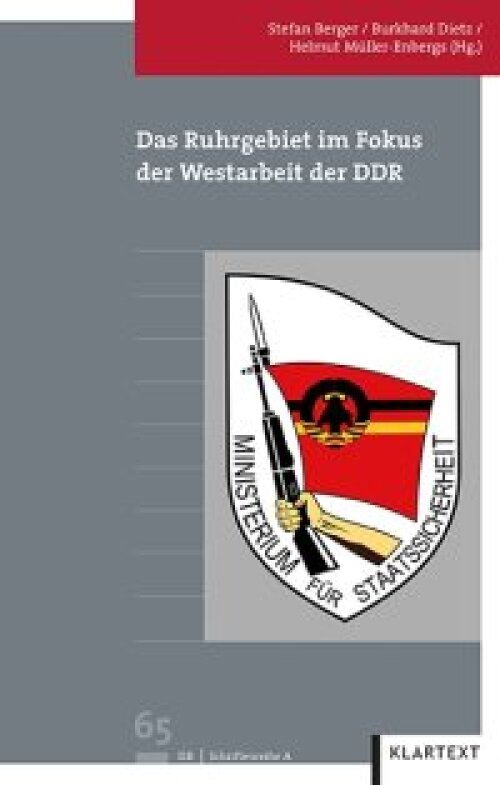
Stefan Berger/ Burkhard Dietz/ Helmut Müller-Engbers (Hg.) 2020
Das Ruhrgebiet im Fokus der Westarbeit der DDR
Band 65
Als „Westarbeit“ bezeichnet wurden in der DDR Aktivitäten eigener Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland. Dies umfasste klassische Spionagetätigkeiten, aber auch andere Maßnahmen, die eine destabilisierende Einflussnahme auf den westdeutschen Staat beabsichtigten.
Das Ruhrgebiet gehörte zu den Regionen mit dem höchsten Stellenwert innerhalb der „Westarbeit“. Es war für den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Westdeutschland und inWesteuropa bedeutsam, seine Gesellschaft war ausgesprochen proletarisch geprägt, und es wurde bereits am Ende der 1950er Jahre von einer tiefen wirtschaftlichen Strukturkrise erfasst. So schienen hier die Voraussetzungen zur Herbeiführung einer revolutionären Situation in Westdeutschland als strategisches Ziel der „Westarbeit“ besonders günstig.
Der Band bietet eine Bestandsaufnahme der auf das Ruhrgebiet gerichteten Aktivitäten der „Westarbeit“. Die Beiträge thematisieren wichtige Zielobjekte der „Westarbeit“ im Ruhrgebiet, wie Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften, Kirchen, Friedensbewegung und politische Parteien, oder stellen ihre Träger in den Mittelpunkt, wie der Abt. Verkehr im Zentralkomitee der SED, der FDJoder dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands.
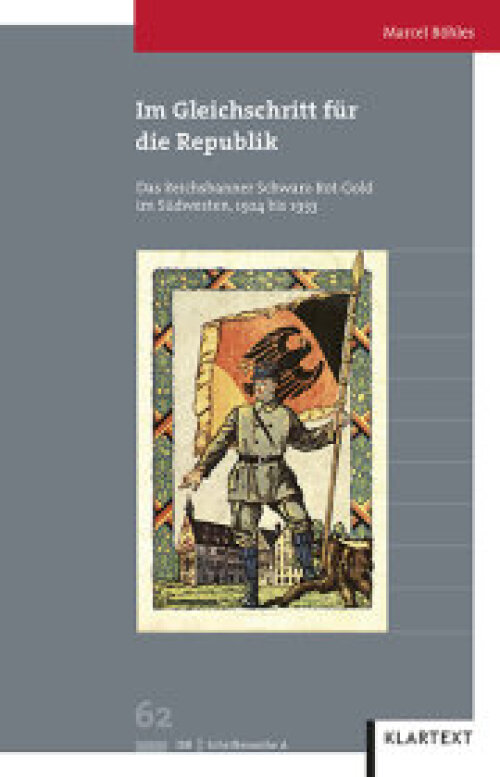
Marcel Böhles 2016
Im Gleichschritt für die Republik
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Baden und Württemberg, 1924 bis 1933
Band 62
Das 1924 gegründete Reichsbanner Schwarz – Rot – Gold, Bund Deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner, stellte als überparteiliche, militant orientierte Sammlungsbewegung der „Weimarer Koalition“ aus SPD, Zentrum und DDP den einzig ernstzunehmenden Versuch dar, Republikaner und Demokraten aus unterschiedlichen politischen Lagern im Kampf gegen die Feinde der Republik zu vereinen. Marcel Böhles untersucht Wirken und Scheitern des Reichsbanners in einer Regionalstudie zu Baden und Württemberg. Im Vordergrund stehen dabei das ambivalente Verhältnis des Reichsbanners zu seinen Trägerparteien, sein erinnerungs- und symbolpolitischer Kampf um die Deutungshoheit des Weltkriegserlebnisses, das „biedere“ Innenleben des nach außen oft martialisch auftretenden Kampfbundes sowie die internen Auseinandersetzungen zu den Fragen von Legalität, Notwehr und Einsatz von Gewalt.
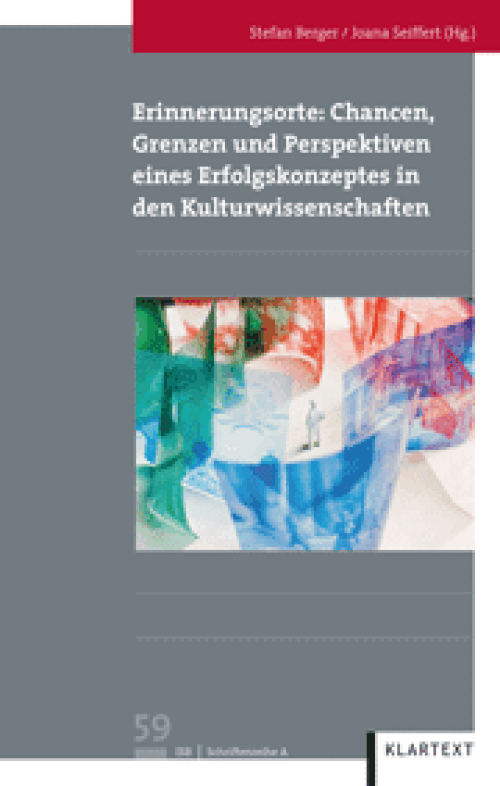
Stefan Berger/ Joana Seiffert (Hg.) 2014
Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kultur- wissenschaften
Band 59
Seit seiner Erfindung durch Pierre Nora in den 1980er Jahren hat das Konzept der Erinnerungsorte eine ganze Lawine von Literatur in den Kulturwissenschaften ausgelöst und sich zu einem „Erfolgskonzept“ sondergleichen entwickelt.
Die Beiträge des Sammelbands beschäftigen sich mit der Frage „Was ist ein Erinnerungsort und wie entsteht er?“ und stellen dieses Erfolgskonzept wiederum auf den Prüfstand: Wie hat es sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Wie wurde es adaptiert und entwickelt? Welche Stärken und Schwächen hat es in dieser Zeit gezeigt? Die Autoren geben aus unterschiedlichen Perspektiven Antworten auf diese Fragen und loten aus, inwiefern es sich bei dem Konzept der Erinnerungsorte um ein taugliches Konzept handelt, das man auch für die Untersuchung von Erinnerungsdiskursen im Ruhrgebiet sinnvoll anwenden kann.
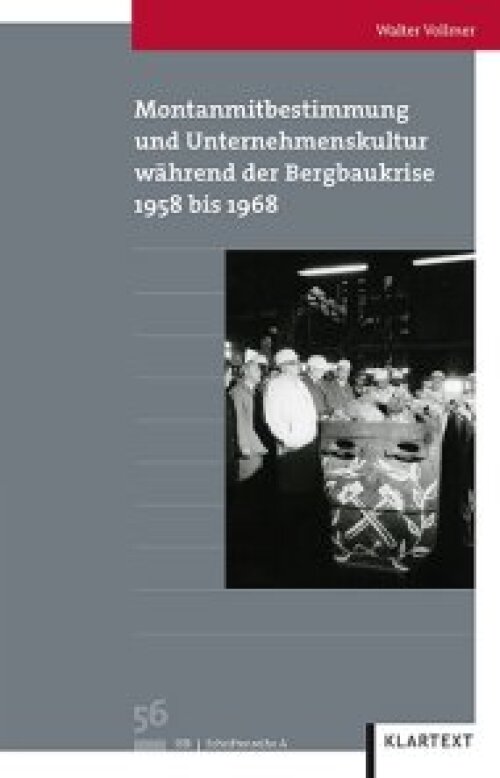
Walter Vollmer 2013
Montanmitbestimmung und Unternehmens- kultur während der Bergbaukrise, 1957-1968
Band 56
Das erste Jahrzehnt der Bergbaukrise bis 1968, das mit dem Verlust Zehntausender Arbeitsplätze einherging, stellte einen Testfall für die Funktionsweise eines auf Parität setzenden Mitbestimmungsmodells dar. Die Montanmitbestimmung kennt sehr viel weitergehende Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer auf der Ebene der Unternehmensvorstände und -aufsichtsräte als die in anderen Branchen geltenden Mitbestimmungsregeln. Das Buch von Walter Vollmer untersucht, wie die konkreten Entscheidungsprozesse, die zu Zechenstilllegungen führten, zwischen den Sozialpartnern in den Bergbauunternehmen verliefen. Der Autor zeigt, dass die Montanbestimmung wesentlich zu einer Kultur der „Konfliktpartnerschaft“ zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beitrug, die erheblich mithalf, die mit dem Belegschaftsabbau verbundenen sozialen Lasten zu bewältigen.
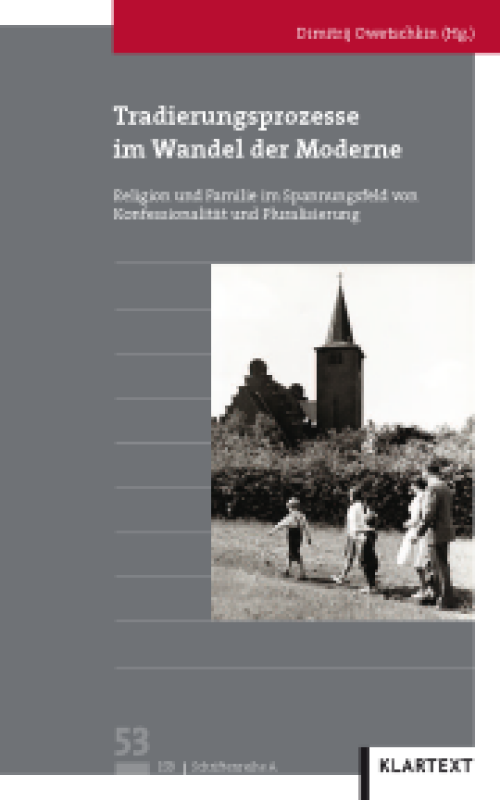
Dimitrij Owetschkin (Hg.) 2012
Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne
Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung
Band 53
In der Entwicklung der Moderne kam Tradierungs- und Sozialisationsprozessen eine zentrale Bedeutung zu. Durch sie wurden der soziale Wandel, aber auch seine Krisenhaftigkeit und die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ vermittelt. Religion und Familie stellten dabei gesellschaftliche Teilbereiche dar, in denen solche Diskontinuitäten und Kontinuitäten in einer besonders bezeichnenden Weise zum Vorschein kamen. Zugleich waren sie selbst tiefgreifenden Transformationsprozessen unterworfen. Diesen Transformationen und ihren Wechselwirkungen mit dem Wandel der Moderne in der zweiten Hälfte des 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert wird in dem Band aus interdisziplinären und internationalen Perspektiven nachgegangen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Wandel der Konfessionalität, den intergenerationellen Beziehungen sowie der Entwicklung von – christlicher und nichtchristlicher – Religiosität und Identität in pluralisitischen, vor allem migrationsbedingten Kontexten.
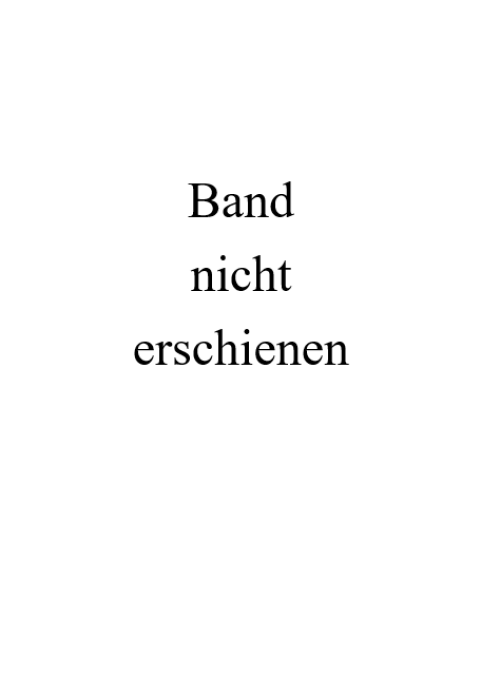
Jürgen Mittag/Klaus Tenfelde (Hg.) 2012
Towards transnational trade union cooperation?
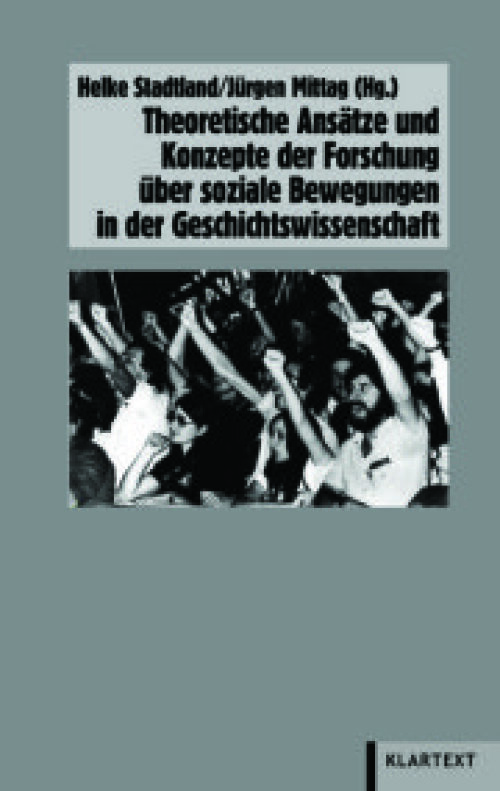
Helke Stadtland/Jürgen Mittag (Hg.) 2014
Theoretische Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale Bewegungen in der Geschichtswissenschaft
Band 47
Angesichts ihrer Bedeutung für die Entwicklung von modernen Gesellschaften sind soziale Bewegungen zunehmend in das Blickfeld der historischen Forschung gerückt. Die vorliegenden historiografischen Arbeiten haben sich bislang jedoch kaum mit konzeptionellen Ansätzen und Zugängen zur Forschung über soziale Bewegungen befasst. Vor diesem Hintergrund beleuchten die Beiträge dieses Bandes den Stand und die Perspektiven der historischen Bewegungsforschung in Bezug auf ihre theoretische und konzeptionelle Dimension. In empirischen Fallstudien werden gängige Theoreme der Bewegungsforschung einer näheren Betrachtung unterzogen. Die vor allem seitens der Sozialwissenschaften entwickelten Ansätze werden auf historische Fragestellungen und Quellen bezogen und im Hinblick auf ihre analytische Tragweite – sowie ihre Grenzen – analysiert.
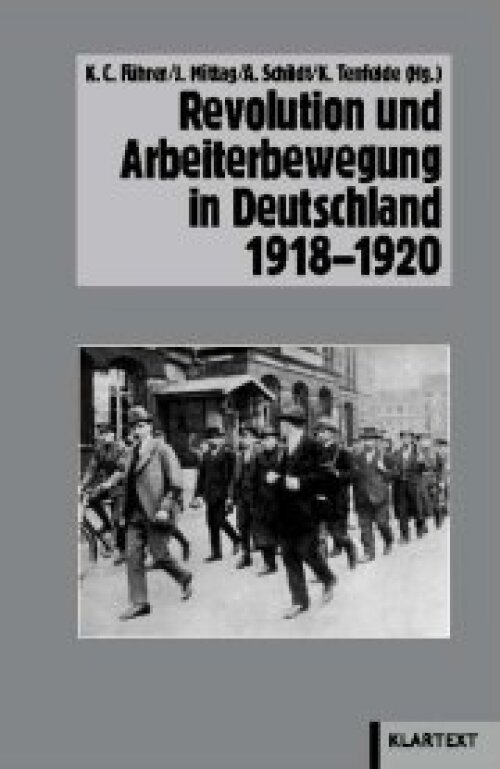
Karl Christian Führer/ Jürgen Mittag/ Axel Schildt/ Klaus Tenfelde 2010
Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1920
Band 44
Über die revolutionären Ereignisse und Umwälzungen der Jahre 1918 bis 1920, die vielfach noch immer als "Novemberrevolution" etikettiert werden, sind in der deutschen und internationalen Forschung seit etwa zwei Dekaden kaum noch Forschungsanstrengungen betrieben worden. Damit ist auch die entscheidende Rolle der Arbeiterbewegung für den Verlauf der Revolution und die Demokratisierung Deutschlands im frühen 20. Jahrhundert aus dem Blickfeld geraten. Vor diesem Hintergrund beleuchtet der Band – der auf zwei wissenschaftlichen Tagungen in Hamburg und Bochum basiert – insbesondere die Rolle der Arbeiterbewegungen während der Revolution sowie die damit verbundenen Folgen und Wirkungen. Das Spektrum der Beiträge reicht dabei vom Stinnes-Legien-Abkommen über die Revolutionsereignisse bis zu den politischen und sozialen Umwälzungen der Folgejahre. Dem Ruhrgebiet, als einem Brennpunkt der Ereignisse, wird dabei besondere Aufmerksamkeit beigemessen.
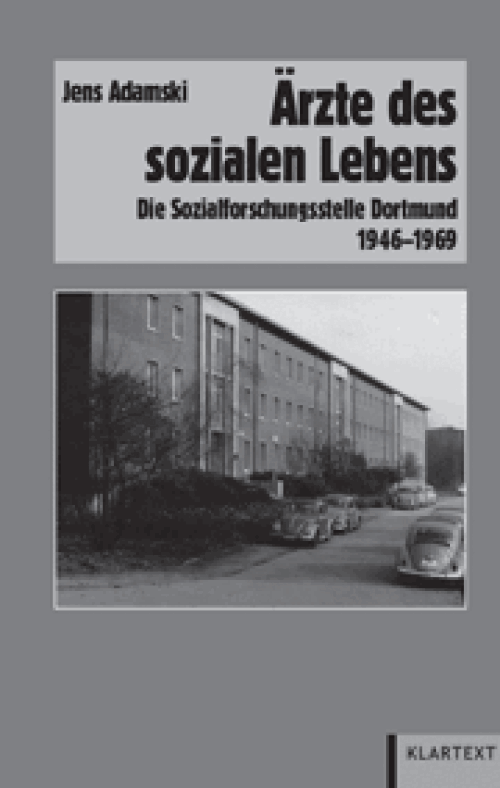
Jens Adamski 2009
Ärzte des sozialen Lebens
Die Sozial-forschungsstelle Dortmund 1946-1969
Band 41
Die „Sozialforschungsstelle an der Universität Münster, Sitz zu Dortmund“ leistete in den 1950er und 1960er Jahren als größte deutsche Einrichtung für die Sondierung sozialer Tatbestände einen impulsgebenden Beitrag zur Formierung und Etablierung der empirischen Sozialforschung. Als Bindeglied zwischen sozialwissenschaftlicher Forschung und öffentlichem Leben verpflichtete sich die Institution bei ihrer Gründung einem dienstleistungsorientierten Forschungsdesign, das einen Beitrag zur Stabilisierung und Harmonisierung der Nachkriegsverhältnisse leisten sollte. Der Fokus der vorgelegten Publikation richtet sich auf die wissenschaftlichen Akteure der Sozialforschungsstelle, die im Hinblick auf ihre Leitbilder, Sozialisationserfahrungen, Netzwerke, Instrumentarien sowie ihr wissenschaftliches Milieu und gesellschaftspolitisches Umfeld hin untersucht werden. Dabei zeigt sich, wie stark ordnungswissenschaftliche Motive, tradierte Denkmuster sowie personelle, institutionelle, inhaltliche und methodische Kontinuitäten die Entwicklung der empirischen Sozialforschung in der Bundesrepublik Deutschland beeinflussten.
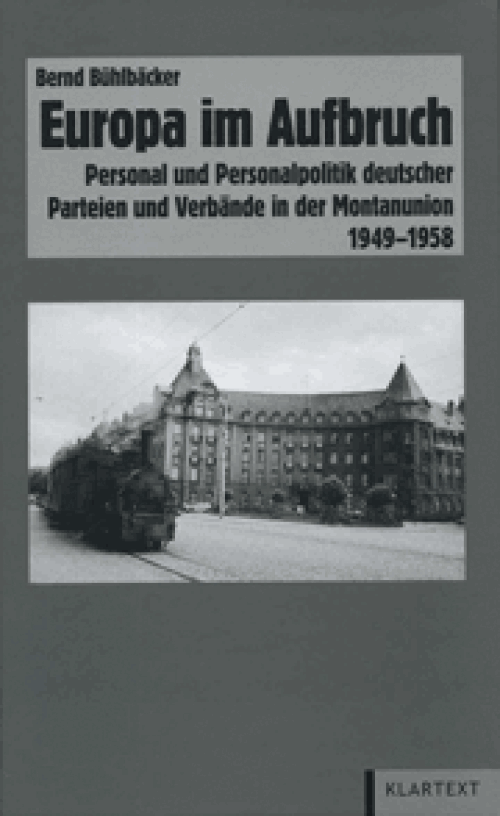
Bernd Bühlbäcker 2007
Europa im Aufbruch
Personal und Personalpolitik deutscher Parteien und Verbände in der Montanunion 1949-1958
Band 38
Obwohl der Schumanplan und die aus ihm resultierende Montanunion intensiv erforschte Bereiche der Geschichte der europäischen Integration sind, liegen kritische Studien zum individuellen und kollektiven Wirken von einzelnen Personen bzw. Personengruppen nur in sehr begrenztem Umfang vor. Auf der Grundlage neuer Quellen und Materialien werden in der vorliegenden Studie erstmalig Persönlichkeiten aus der sogenannten zweiten Reihe der frühen europäischen Integrationsgeschichte umfassend gewürdigt. Hierbei stehen nicht die großen Ideengeber und Initiatoren des frühen Einigungswerkes im Vordergrund, sondern verbands- und parteipolitische Spezialisten der CDU, der SPD und der deutschen Gewerkschaften, die für die BRD am Aufbau der ersten supranationalen Behörde mitgewirkt und diese letztlich geprägt haben.
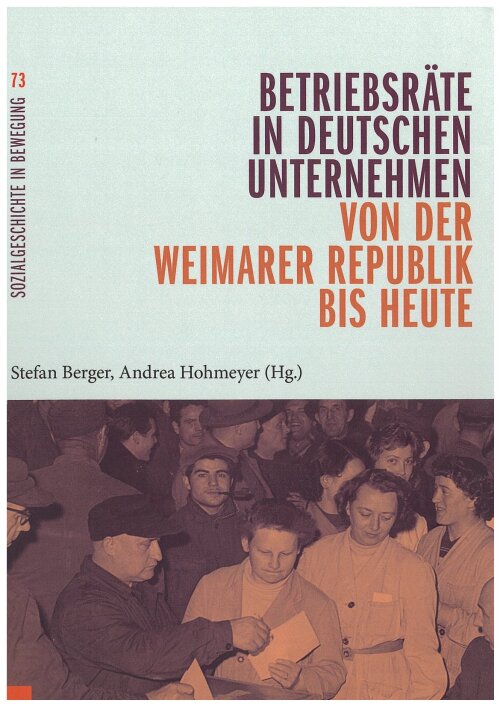
Stefan Berger (Hg.), Andrea Hohmeyer (Hg.)
Betriebsräte in deutschen Unternehmen von der Weimarer Republik bis heute
Band 73
Die deutsche Kultur der Mitbestimmung ist integraler Bestandteil eines Verständnisses von sozialer Demokratie als Ergänzung der politischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird in dem hier vorgelegten Band von ihren Anfängen in den Jahren der Weimarer Republik bis zu unserer Gegenwart in ihren unterschiedlichen Facetten untersucht. Dabei wird deutlich, wie sehr mitbestimmte Unternehmen nicht nur wirtschaftlich effizienter waren und sind, sondern auch demokratische Teilhabe ihrer Beschäftigten versprechen. Als Labore der Demokratie sind sie die Grundlage eines ‚eingebetteten Kapitalismus‘ im Sinne Karl Polanyis, der eben nicht nur nach dem ‚stakeholder value‘ fragt, sondern sich auch sozialer Gerechtigkeit verpflichtet sieht. Die hier versammelten Beiträge verdeutlichen, wie zentral die Mitbestimmung für das demokratische Selbstverständnis der Bundesrepublik war und wie Modelle künftiger Mitbestimmung in Zukunft mehr Demokratie hervorbringen können.
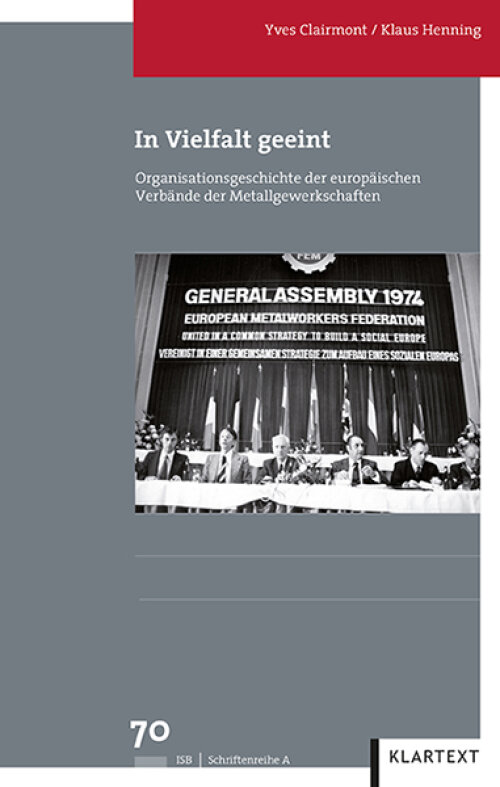
Yves Clairmont, Klaus Henning (Hg.) 2022
In Vielfalt geeint
Organisationsgeschichte der europäischen Verbände der Metallgewerkschaften
Band 70
Die Gewerkschaften schufen schon mit Beginn der Europäischen Integration eigene Organisationsstrukturen für den Gemeinschaftsraum. Unter den Europäischen Gewerkschaftsverbänden nahm der Zusammenschluss der traditionell führenden Metallgewerkschaften dabei eine herausragende Stellung ein. Die Autoren zeichnen die Entwicklungsstadien metallgewerkschaftlicher Organisation nach und stellen sie in den Kontext ihrer jeweiligen zeit - und integrationsgeschichtlichen Rahmenbedingungen.
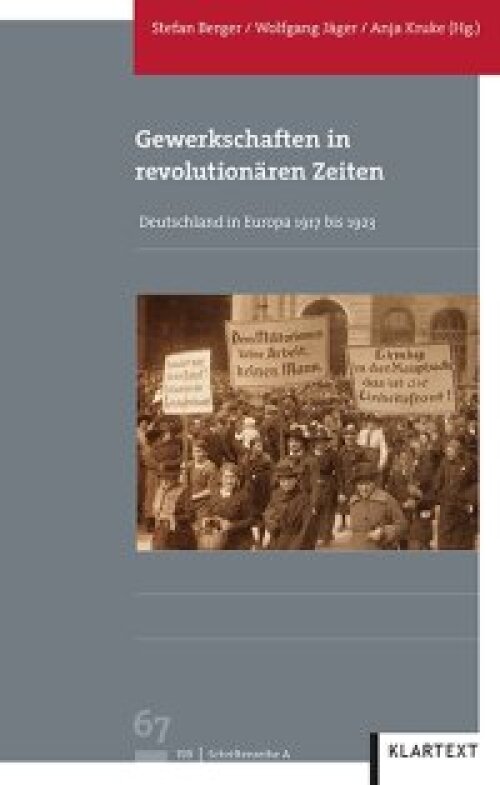
Stefan Berger, Wolfgang Jäger, Anja Kruke (Hg.) 2021
Gewerkschaften in revolutionären Zeiten
Deutschland in Europa 1917 bis 1923
Band 67
Der 100. Jahrestag der deutschen Revolution von 1918 hat eine breite öffentliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit gefunden.
Die Debatten über die Ereignisse von 1917 bis 1923 konzentrierten sich vor allem auf die grundlegenden Veränderungen der politischen Demokratie. Weniger Beachtung fanden dagegen die fundamentalen Weiterentwicklungen der sozialen Demokratie, die den Gewerkschaften neue und umfassende Aufgaben bescherten. Im vorliegenden Band, der auf eine Tagung der Hans-Böckler-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets im Herbst 2018 zurückgeht, diskutieren 23 Historiker*innen in vier Sektionen die Beiträge der Gewerkschaften zur demokratischen Neugestaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und zum Teil auch in europäisch vergleichender Perspektive.
In den Blick kommen der Kampf um die politische Neuordnung, das Spannungsverhältnis der Gewerkschaften zwischen Nationalismus und Internationalismus, die Auseinandersetzungen um die Neuordnung der Wirtschaft und die umstrittene Erinnerung an die Revolution. Der demokratische und soziale Aufbruch in vielen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg wird interpretiert als Teil einer Geschichte der Emanzipation, die noch lange nicht an ihr Ende gekommen ist.
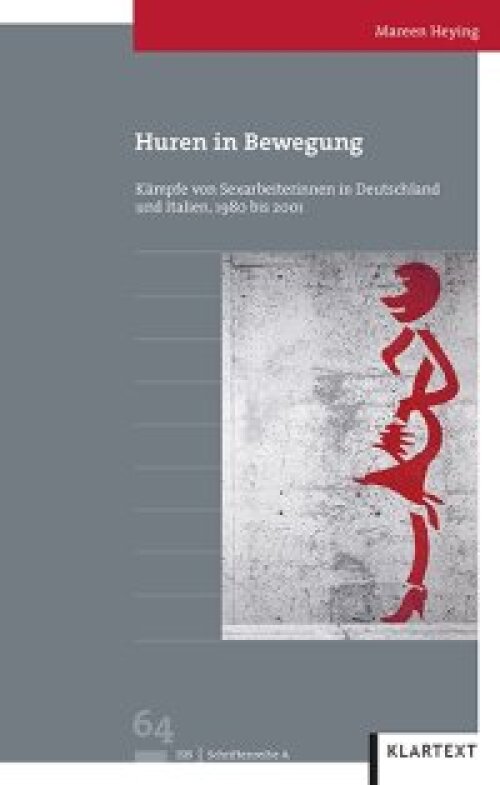
Mareen Heying 2019
Huren in Bewegung
Kämpfe von Sexarbeiterinnen in Deutschland und Italien, 1980 bis 2001
Band 64
In den 1980er Jahren begannen Sexarbeiterinnen in Deutschland und in Italien sich zusammenzuschließen, um für ihre gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung zu kämpfen. Die sich formierenden sozialen Bewegungen stritten für eine rechtliche Absicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit, für das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und für eine Gesellschaft ohne Machtgefälle zwischen den Geschlechtern. Mareen Heying geht der Entwicklung der Bewegungen bis zum Ende der 1990er Jahre nach. Im Zentrum der Untersuchung steht die vergleichende Analyse der Inhalte und Formen des Protests.
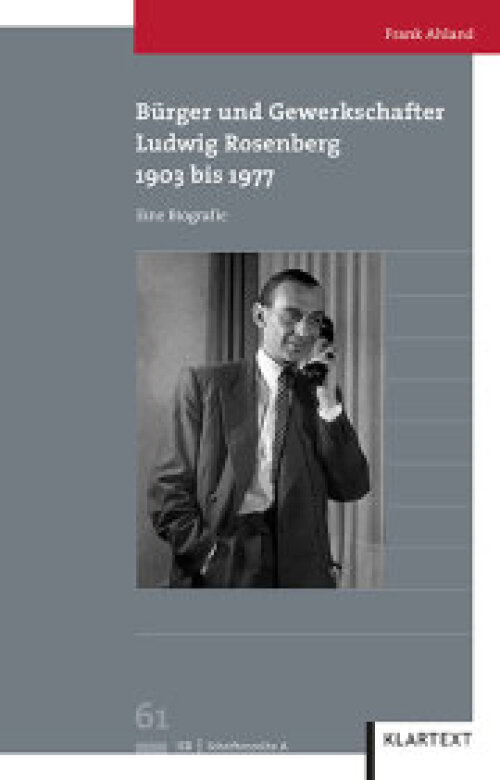
Frank Ahland 2016
Bürger und Gewerkschafter
Ludwig Rosenberg, 1903 bis 1977. Eine Biografie
Band 61
Ludwig Rosenberg, der in Herkunft und Habitus vielleicht bürgerlichste deutsche Gewerkschafter, gehörte zwanzig Jahre lang, davon sieben als Vorsitzender (1962-1969), dem geschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes an, den er entscheidend mitprägte: Die zügige Wiedereingliederung der Gewerkschaften in die internationale Gewerkschaftsbewegung, ihr überaus starkes Engagement im Prozess der europäischen Integration und der Entstehung der Europäischen Gemeinschaften und die Neukonzeption der gewerkschaftlichen Programmatik sind ohne sein Wirken nicht denkbar. Es gelang ihm, den im Konzert starker Einzelgewerkschaften objektiv schwach aufgestellten Dachverband durch krisenhafte Situationen zu manövrieren und den DGB als einflussreichen gesellschaftlichen Akteur zu verankern. Sein besonderes Augenmerk lag dabei stets auf der Ausgestaltung einer entwickelten pluralistischen Demokratie und des Verhältnisses zu Israel.
Seine Biografie veranschaulicht anschaulich komplexe Vorgänge für eine breite Leserschaft und erweitert den lückenhaften Kenntnisstand über die Gewerkschaftselite im Allgemeinen wie auch die Kenntnis der Gewerkschaftsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ermöglicht einen vertiefenden Blick auf die Binnenstrukturen des Dachverbands der Gewerkschaften in den 1950er und 1960er Jahren, auf das Verhältnis der Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften zum geschäftsführenden Bundesvorstand.
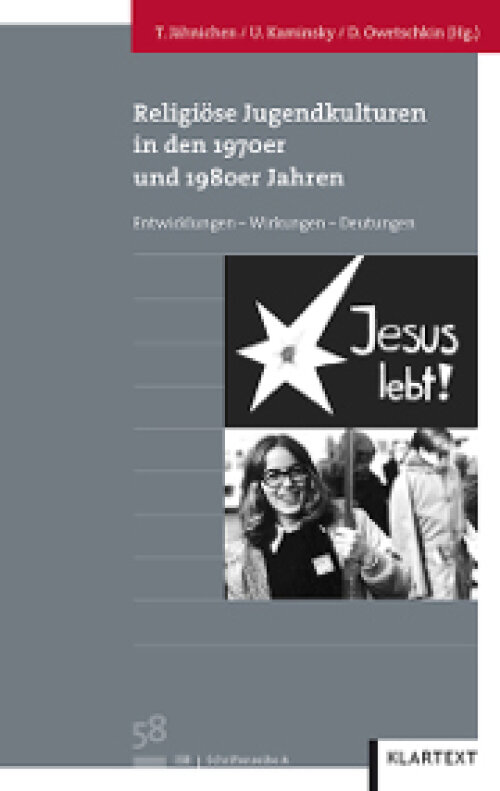
Traugott Jähnichen/Uwe Kaminsky/Dimitrij Owetschkin (Hg.) 2014
Religiöse Jugendkulturen in den 1970ern und 1980er Jahren
Entwicklungen – Wirkungen – Deutungen
Band 58
Das Verhältnis von Jugend, Religion und Kirchen in den 1970er und 1980er Jahren zeichnete sich durch Umbrüche und Ambivalenzen aus. Für die Entwicklung religiöser Jugendkulturen waren dabei die Prozesse der Politisierung, Pluralisierung und des Wandels von Werthaltungen und Verhaltensorientierungen prägend. Den Auswirkungen und gesellschaftlichen Hintergründen dieser Prozesse gehen die Beiträge des Bandes aus interdisziplinären Perspektiven nach. Besonderes Augenmerk gilt u. a. „neuen Jugendreligionen“ und kirchlichen Akademien, religiösen Jugendorganisationen und der Rolle der Kirchen im Umfeld von neuen sozialen Bewegungen, der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung und den Wandlungen der religiösen Sozialisation. Durch Analysen zu den Entwicklungen religiöser Jugendkulturen in der DDR und den Niederlanden werden auch vergleichende Dimensionen einbezogen.

Gunnar Gawehn 2014
Zollverein
Eine Ruhrgebietszeche im Industriezeitalter, 1847-1914
Band 55
Die Zeche Zollverein, die 1986 nach fast 120-jähriger Geschichte 1986 als letztes Essener Bergwerk stillgelegt wurde, galt lange als „Musterzeche“ des Ruhrbergbaus. Seit 2001 gehört das bauliche Ensemble „Zollverein“ zum Weltkulturerbe der UNESCO. Dagegen war bisher wenig über die Geschichte Zollvereins als förderndes Bergwerk in der industriellen Expansionsphase des Ruhrbergbaus vor 1914 bekannt. Das Buch von Gunnar Gawehn füllt diese Lücke, indem es die Bedeutung der Unternehmerpersönlichkeit Franz Haniel für die Gründung der Zeche herausstellt, deren wirtschaftliche und technische Entwicklung beschreibt, die sozialen Verhältnisse untersucht und die Beziehung der Zeche zu ihrer Standortgemeinde Katernberg analysiert. Damit leistet das Buch einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Ruhrbergbaus im Industriezeitalter.
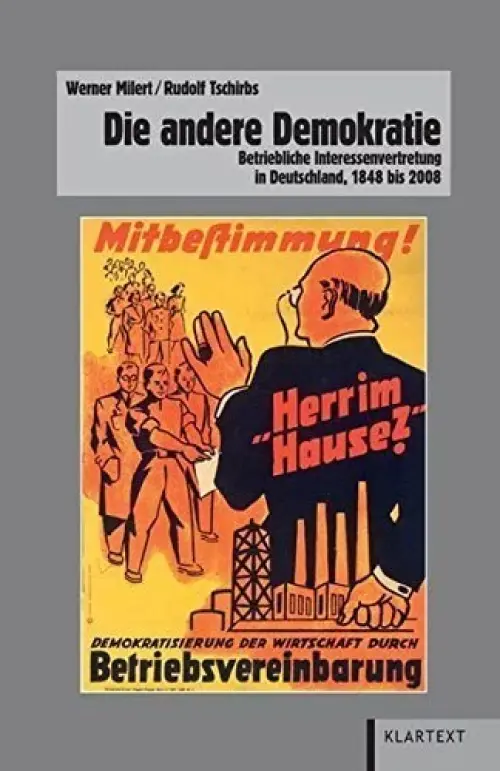
Werner Milert/ Rudolf Tschirbs 2012
Die andere Demokratie
Betriebliche Interessenvertretung in Deutschland, 1848 bis 2008
Band 52
Betriebsräte, die den Beschäftigten Beratung und Schutz im betrieblichen Alltag bieten, gehören heute zur Normalität des Arbeitslebens in Großbetrieben. Das vorliegende Buch zeichnet die dahin führende Entwicklung der betrieblichen Interessenvertretung über anderthalb Jahrhunderte nach und verdeutlicht,dass die Herausbildung der „anderen Demokratie“ keineswegs selbstverständlich war. Nach betriebsdemokratischen Anstößen in der Revolution von 1848/49 tat sich im Kaiserreich eine tiefe Kluft zwischen dem Status als freier Staatsbürger und geknechteter Arbeitsbürger auf. Erst das Zweckbündnis von Militär und Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg führte zu verbindlichen betrieblichen Vertretungsstrukturen, die in das Betriebsrätegesetz von 1920 mündeten. Die fortschrittliche Weimarer Betriebsverfassung wurde im Nationalsozialismus brutal zerstört, doch nach dem Zweiten Weltkrieg erwuchs gerade aus den Betrieben heraus der demokratische Neubeginn. In der Bundesrepublik
wurde die betriebliche Mitbestimmung zu einem wichtigen Fundament der industriellen Beziehungen, in der DDR dagegen opferte man die Betriebsräte dem Nacheifern sowjetischer Vorbilder. Nach der Wiedervereinigung blieb die Institution des Betriebsrates zentraler Bestandteil eines „Laboratoriums der
Demokratie in der Arbeitswelt“.
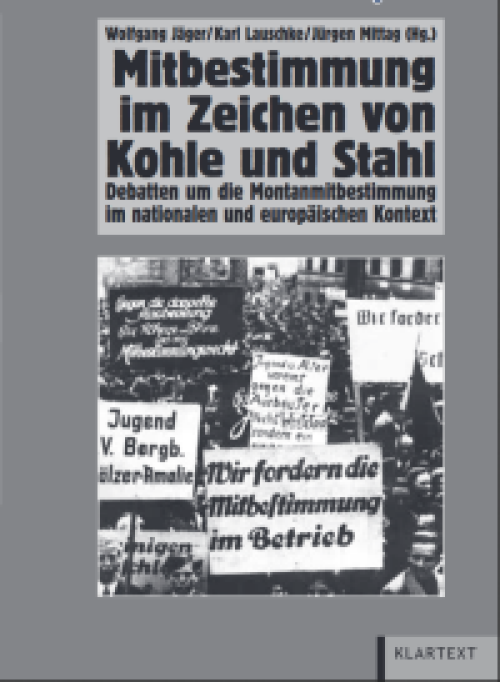
Wolfgang Jäger/ Karl Lauschke/ Jürgen Mittag 2020 (Hg.)
Mitbestimmung im Zeichen von Kohle und Stahl
Debatten um die Montanmitbestimmung im nationalen und europäischen Kontext
Band 49
Den Auseinandersetzungen um das Montanmitbestimmungsgesetz wird im historischen Rückblick nicht nur für die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen in Deutschland, sondern auch für die Fundierung der Demokratie eine wichtige Funktion zugesprochen. Zugleich spiegeln sich in den Auseinandersetzungen über das Montanmitbestimmungsgesetz auch die Debatten über die Stellung der Gewerkschaften im modernen Staat und über die Ausgestaltung der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland wider.
Die Beiträge des Bandes wurden im Rahmen einer interdisziplinären Fachtagung aus Anlass des 60. Jahrestages der Veröffentlichung des Montanmitbestimmungsgesetzes am 21. Mai 1951 präsentiert. Beleuchtet werden neben dem historischen Hintergrund der Montanmitbestimmung in Deutschland und Europa sowie den innergewerkschaftlichen Debatten auch die längerfristigen Entwicklungslinien der Mitbestimmung -- sowohl aus historiografischer als auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive.
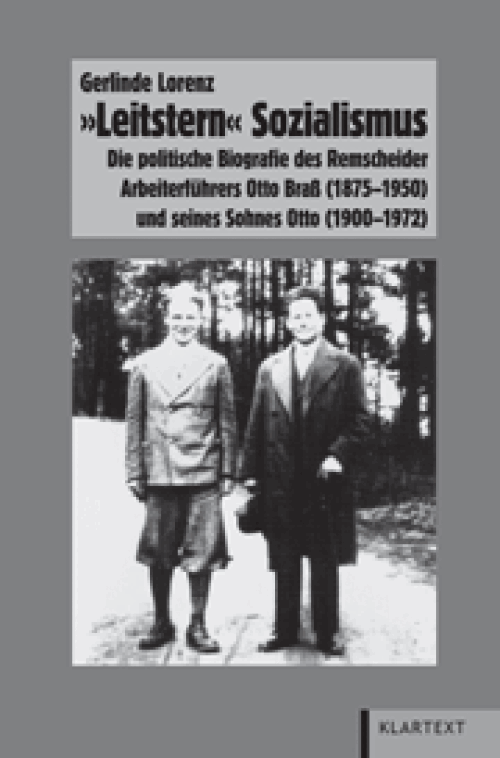
Gerlinde Lorenz 2010
"Leitstern" Sozialismus
Die politische Biografie des Remscheider Arbeiterführers Otto Braß (1875–1950) und seines Sohnes Otto (1900–1972)
Band 46
Vater und Sohn Otto Braß – zwei radikale Linkssozialisten, deren Lebensweg von der Idee des Sozialismus bestimmt wurde. Braß sen. griff zwischen 1918 und 1920 als Arbeiterführer maßgeblich in das politische Geschehen in der Revolution und frühen Weimarer Republik ein. In seinem politischen Kampf als Abgeordneter der Nationalversammlung und des Reichstags sowie als Widerstandskämpfer gegen Hitler werden die Zielvorstellungen und Konflikte jener Linkssozialisten deutlich, die weder in der SPD noch in der KPD ihre politische Heimat finden konnten.
Die Lebensgeschichte des Sohnes ist schicksalhaft mit der Geschichte des deutschen Kommunismus verwoben. Als
überzeugter Kommunist emigrierte er 1932 in die Sowjetunion, wo er ein Opfer des Terrors Stalins wurde. Diese
Doppelbiografi e beschreibt die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zwischen Kaiserreich und DDR aus der
Perspektive des Linkssozialismus und konkretisiert am Beispiel von Vater und Sohn Otto Braß generationelle Prägungen und Wertvorstellungen.
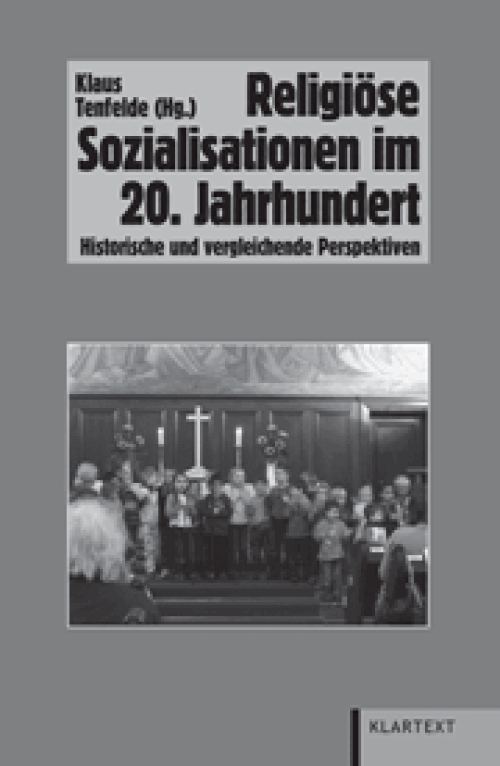
Klaus Tenfelde 2010 (Hg.)
Religiöse Sozialisationen im 20. Jahrhundert
Historische und vergleichende Perspektiven
Band 43
Ausprägungen und Intensität religiösen Verhaltens und religiöser Wertorientierungen unterlagen immer schon erheblichen Schwankungen. Im 20. Jahrhundert, zumal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, setzte ein gravierender Formwandel des Religiösen ein, der mit einem Rückgang traditioneller Kirchlichkeit und einer religiösen Pluralisierung einherging. Die Vermutung, dass dieser Wandel mit Transformationen auf dem Gebiet der Sozialisation zusammenhängt, bildet einen wichtigen Ausgangspunkt für interdisziplinäre religionswissenschaftliche Forschung.
In den Beiträgen des Bandes werden die historische Dimension und einige aktuelle Folgen solcher Transformationsprozesse am Beispiel von innerkirchlichen Sozialisationen, außerkirchlicher Religiosität sowie schichtspezifischen Ausformungen dieser Phänomene in einer vergleichenden, konfessionsübergreifenden und internationalen Perspektive näher analysiert. In den Blick kommen dabei u. a. Vereine und Kongregationen, Jugend und Familie, kirchliche Unterweisung und Schule, deren Wandel in breitere gesellschafts-, religions- und kirchengeschichtliche Kontexte des 20. Jahrhunderts einbezogen wird.
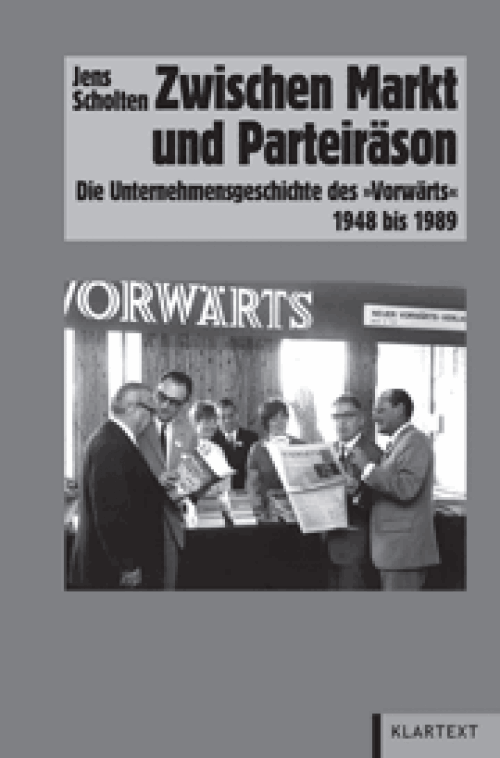
Jens Scholten 2008
Zwischen Markt und Parteiräson
Die Unternehmens- geschichte des "Vorwärts" 1948 bis 1989
Band 40
„Eine Parteizeitung zu redigieren, produzieren und zu verkaufen kommt in diesem Lande einer Quadratur des Kreises gleich.“ Diese Bilanz zog 1976 der frühere Chefredakteur der sozialdemokratischen, frei verkauften Wochenzeitung Vorwärts, Jesco von Puttkamer.
Das traditionsreiche Flaggschiff des SPD-Unternehmensbereichs musste nicht nur in die Öffentlichkeit politisch hineinwirken. Zugleich sollte sein Verlag wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Diese doppelte Aufgabenstellung schlug sich in Konflikten zwischen Politikern, Verlagsmitarbeitern und Journalisten bei der Steuerung des Presseunternehmens nieder. Gleichzeitig galt es, sich dem Wandel der SPD zur Volkspartei und dem gesellschaftlichen Wandel in der Bundesrepublik zu stellen. Die Frage, welche Leistungen und Fehler beim Wirtschaften und Schreiben unter sozialdemokratischen Vorzeichen zu verzeichnen waren, führte bereits in der zeitgenössischen Öffentlichkeit zu heißen Diskussionen und Spekulationen.
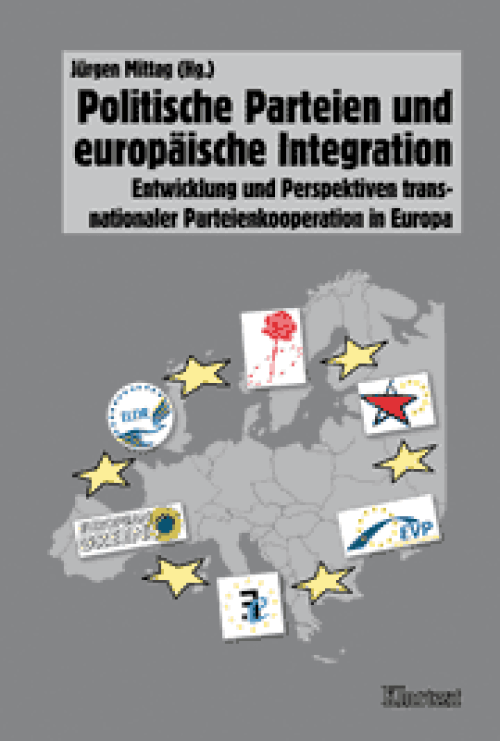
Jürgen Mittag, 2006 (Hg.)
Politische Parteien und europäische Integration
Entwicklung und Perspektiven transnationaler Parteienkooperation in Europa
Die transnationale Zusammenarbeit einander ideologisch nahe stehender Parteien verfügt in Europa über eine lange Tradition. Im Zuge der fortschreitenden europäischen Integration haben grenzüberschreitende Parteienkontakte zu einer erheblichen Verdichtung der Kooperation und zur Formierung europäischer Parteienorganisationen geführt. Die vorliegende Publikation arbeitet die wichtigsten Entwicklungslinien transnationaler Parteienkooperation - aus vorwiegend deutscher Perspektive - für die einzelnen Parteienfamilien überblicksartig heraus. Zugleich wird systematisch untersucht, welche Faktoren die Parteieninteraktion seit ihren Anfängen im 20. Jahrhundert beeinflussten. Besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die Frage, inwieweit die transnationale Parteienzusammenarbeit und die europäische Parteiorganisationen legitimationsstiftendes Potential für die Europäische Union besitzen.
Eine Liste mit den älteren Bänden dieser Reihe (Bd. 36- Bd. 1) finden Sie hier.