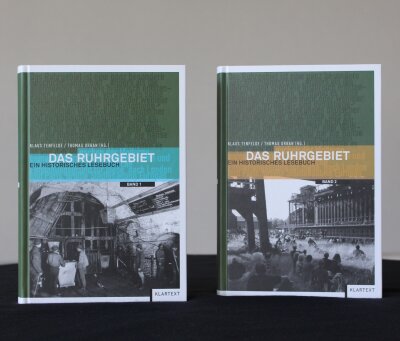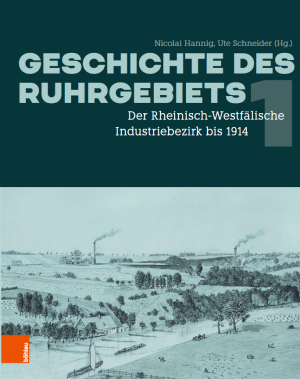
Vom Ruhrgebiet war vor 1914 noch kaum die Rede. Die Zeitgenoss:innen bezeichneten den schwerindustriellen Ballungsraum, der in wenigen Jahrzehnten auf dünn besiedelter, agrarisch geprägter Fläche entstanden war, nüchtern als Rheinisch-Westfälischen Industriebezirk. Die Beiträge des Bandes zeigen, dass es sich bei der Konstituierung dieses jungen Raumes keineswegs um eine zwangsläufige Entwicklung handelte,
sondern die Zukunft offen und unsicher war. In einem langen Zeitraum von der Frühen Neuzeit bis zum Ersten Weltkrieg spüren sie den Lebenswelten,
Erfahrungen und Wahrnehmungen, der Ressourcennutzung und Umweltzerstörung nach. Themen wie Arbeit und Freizeit, Kultur und Religion beleuchtet der Band ebenso wie soziale und politische Konflikte, Mobilität und Migration.
Erscheint im Juni 2025.
Oral History und die Arbeit mit lebensgeschichtlichen Interviews haben in der Historiographie der Deindustrialisierung „von unten“ von Anfang an eine große Rolle gespielt. Nach der anfänglichen Tendenz, den Betrachtungsfokus vor allem in einem lokalen oder regionalen Rahmen zu halten, zeigt sich gegenwärtig ein stärkeres Bemühen, lokale, regionale und nationale Erfahrungen auf internationaler Ebene zu vergleichen und in Beziehung zueinander zu setzen. Hier schließt sich die vorliegende Sammlung mit zehn Beiträgen aus Europa, Kanada und Australien an und fragt einerseits nach den Erfahrungsperspektiven von Menschen im Strukturwandel, andererseits nach den teils umkämpften Formen der Erinnerung an Arbeit und Industrie.
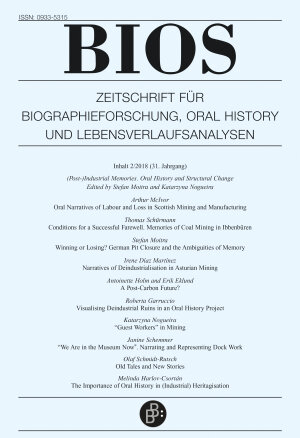
Keine andere Region in Deutschland und Europa weist eine derart hohe wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vielfalt auf wie das Ruhrgebiet. Die mit der Entwicklung zwischen Tradition und Moderne einhergehenden Hoffnungen und Perspektiven, aber auch die Probleme und Krisen sind seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Forschung. Ein „Quellenbuch“, das die am Wandel beteiligten Akteure und Betroffenen ausführlich zu Wort kommen lässt und die Geschichte des Ruhrgebiets erlebbar macht, fehlte jedoch bislang.
Ziel des von der Stiftung Mercator finanzierten Projekts ist die Erstellung einer umfassenden, auf aussagekräftigen und repräsentativen Quellen beruhenden Dokumentation zum Werden, Wachsen und Wandel des Ruhrgebiets von dessen Anfängen Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Das Spektrum reicht dabei vom Aufstieg und Niedergang der Schwerindustrie über die Entwicklung der Städte bis hin zur Rolle des Ruhrgebiets als kulturelles Zentrum.
Die zweibändige Publikation richtet sich gezielt an einen breiten, nicht ausschließlich fachwissenschaftlichen Adressatenkreis: Sie soll u.a. als Arbeitsgrundlage für studentische Seminare, Leistungskurse der gymnasialen Oberstufe oder für Volkshochschulkurse dienen. Das Historische Lesebuch Ruhrgebiet, das als Gemeinschaftswerk der Mitarbeiter und Doktoranden des Instituts für soziale Bewegungen bzw. der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets entstand, ist im Sommer 2010, pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr, erschienen.