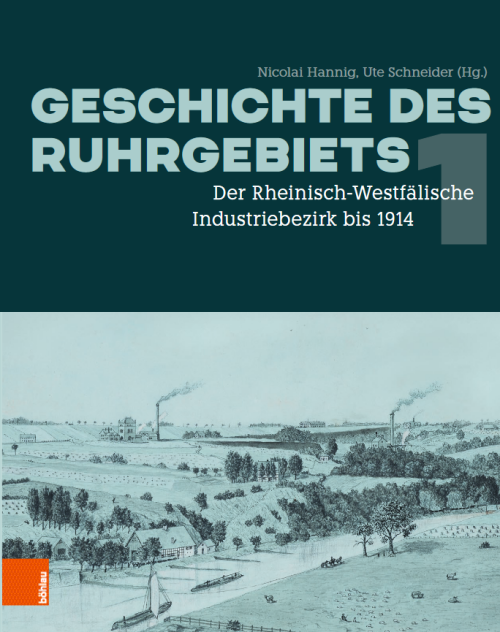
Das Ruhrgebiet ist einer der größten und am dichtesten besiedelten Ballungsräume Europas. Als einstmaliger Motor der Industrialisierung, Kristallisationspunkt der Moderne und Objekt der Begierde internationaler Politik ist es seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einem tiefen Strukturwandel unterworfen und erwies sich gleichzeitig als Vorreiter der Industriekultur. Über das Ruhrgebiet – eine Region, die in vielerlei Hinsicht im Zentrum der deutschen und europäischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert stand – liegt bisher allerdings, trotz verschiedener Versuche und trotz seiner historiographisch herausragenden Bedeutung, keine geschichtswissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung vor. Ein solches Vorhaben stellt sich zwei Herausforderungen: Zum einen produzierte die Erinnerungskultur wirkmächtige und dominante Narrative, die es kritisch zu hinterfragen und zu historisieren gilt. Zum anderen basierte der Siegeszug der Ruhrgebietsgeschichte auf einer engen Symbiose mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Kultur- und wissenshistorische Ansätze fanden bislang nur sporadisch EingaDie Geschichte des Ruhrgebiets – eine Gesamtdarstellungng in die Historiographie dieser Industrieregion.
Die Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets erstellt mit Unterstützung der RAG-Stiftung eine mehrbändige Gesamtdarstellung der Geschichte des Ruhrgebiets. Ziel ist eine wissenschaftliche Darstellung, die sich gleichwohl an ein breiteres Publikum wendet. Das Gesamtwerk soll zudem – ohne die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu vernachlässigen – die bisher starke sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fixierung der Ruhrgebietsgeschichte aufbrechen und den jüngeren methodischen und analytischen Entwicklungen in der Geschichtswissenschaft Rechnung tragen.
Kontakt: Dr. Jens Adamski: jens.adamski@ruhr-uni-bochum.de
Das Projekt schafft Zugänge zu Schlüsselquellen dreier Gewerkschaften, die 1945 gegründet sich 1997 zur Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IGBCE) vereinigten. Zunächst werden die Archive der IG Chemie Papier Keramik, der IG Bergbau und der Gewerkschaft Leder gesichtet, Schlüsselquellen identifiziert, diese werden digitalisiert, in einer Datenbank abgelegt, zusammengefasst, in ihren (gewerkschafts-)politischen Kontext eingeordnet, verschlagwortet und durch andere Quellen ergänzt. Aktuelle und vergangene Erinnerungskulturen werdenidentifizierbar. Zudem entsteht eine Quellensammlung über die Geschichte der Bundesrepublik aus Sicht dreier Gewerkschaften entlang der Auseinandersetzungen, in die sie gingen, um dem wirtschaftlichen auch sozialen Fortschritt abzuringen. Teil des Vorhabens ist auch die Herausgabe eines Quellenbandes.
Kontakt: Dr. Hilmar Höhn: hilmarhoehn@icloud.com
Klicken Sie auf das Bild für eine Vergößerte Ansicht des Dokuments.
Das Ruhrgebiet stellte über lange Phasen seiner jüngeren Geschichte die wichtigste europäische Montanregion dar. Zugleich galt es über lange als stark bildungsferne Region, weil ihm Einrichtungen der „höheren“ Bildung vollständig fehlten (Universitäten) oder nur spärlich vorhanden waren (Gymnasien). Seit den 1960er Jahren, parallel zum fortschreitenden Rückbau der Montanindustrie, hat sich das Ruhrgebiet zu einer der differenziertesten und dichtesten Bildungslandschaften in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt; die Förderung und Etablierung von Bildung und Wissenschaft war und ist ein zentraler Bestandteil des regionalen Strukturwandels. Zudem ist die Montanindustrie selbst ein wesentlicher Akteur dieses regionalen Strukturwandels zur Wissens- und Bildungsregion.
Vor diesem Hintergrund fördert das Stipendienprogramm Qualifikationsarbeiten, die einen Beitrag zu den folgenden Themen- und Fragekomplexen leisten:
Erstens stellt sich die Frage, ob und wie bildungsfern Montanregionen in ihrer wirtschaftlichen Blüte tatsächlich waren. Welche bildungspolitischen Initiativen gingen von den Akteuren der Montanwirtschaft (Unternehmen, Gewerkschaften, Gemeinschaftsorganisationen, staatliche Bergbauverwaltung) aus? Wie entwickelte sich die Bedeutung schulischer, beruflicher oder akademischer Bildung innerhalb der Montanwirtschaft? Wie verhielt sich die Montanwirtschaft zur Bildungspolitik außerhalb des eigenen Sektors? Welche Ziele und Motivationen bergbaulicher Bildungspolitik lassen sich erkennen?
Zweitens ist die Bedeutung von Bildung und Bildungspolitik für den Strukturwandel in (ehemaligen) Montanregionen zu untersuchen. Auch ist die Akteursrolle der Montanwirtschaft im Strukturwandel zur Bildungsregion in den Blick zu nehmen.
Drittens stellt sich in vergleichender Perspektive die Frage, ob sich bestimmte Muster der Bildungs- und Wissensgeschichte in deutschen und europäischen Montanregionen zeigen. Entspricht der Weg des Ruhrgebiets von der bildungsfernen Industrielandschaft zur Bildungs- und Wissensregion einem Muster, das sich auch in anderen europäischen Montanregionen identifizieren lässt? Ist Bildung ein Schlüsselelement für einen erfolgreichen Strukturwandel?
Geförderte Postdoc- und zwei Dissertationsprojekte:
Die Schließung der letzten deutschen Steinkohlenzechen in Bottrop und Ibbenbüren Ende 2018 bedeutet in vielfacher Hinsicht eine Zäsur. Der industrielle Steinkohlenbergbau hat auf die Gestalt und Entwicklung seiner regionalen Umgebung in einem Maße Einfluss genommen wie kaum ein anderer Industriezweig. Er dominierte die jeweilige regionale Wirtschaftsstruktur und den Arbeitsmarkt, er veränderte Umwelt und Landschaftsgestalt in seinen Förderregionen dauerhaft, er schuf ganz spezifische Arbeitswelten und regionale Gesellschaften, und er prägte die Identität von Menschen und Regionen in besonderer Weise. Der Steinkohlenbergbau entfaltete so eine historische Wirkmächtigkeit für seine regionale Umgebung, die das Ende seiner Fördertätigkeit um lange Zeit überdauern wird.
Zugleich war die Branche selbst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vielfältigen Veränderungen ausgesetzt. Der Wiederaufbau nach 1945, die Bergbaukrise seit 1958 und die ein Jahrzehnt später stattfindende Gründung der Ruhrkohle AG, der tiefgreifende technische Wandel im Untertagebetrieb, die Einführung der Montanmitbestimmung als folgenreiche sozialpolitische Innovation, diverse Migrationswellen und schließlich die Folgen des allmählichen Schrumpfungsprozesses in den Bergbaurevieren – all dies sind Aspekte, die die Steinkohlenindustrie seit 1945 nachhaltig geprägt haben. Zu fragen ist allerdings, wie die Menschen vor Ort, also die historischen Akteure selbst, diese vielfältigen Entwicklungen erlebt haben und rückblickend einschätzen. Hier setzt das gemeinsam vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum/montan.dok und von der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets getragene Oral-History-Projekt „Digitaler Gedächtnisspeicher: Menschen im Bergbau“ an. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen ca. 80 bis 100 lebensgeschichtliche Interviews zusammengetragen werden, vorrangig im Ruhrgebiet, aber auch in anderen Revieren wie in Aachen, Ibbenbüren und im Saarland.
„Menschen im Bergbau“ sind Menschen, die nach 1945 im Steinkohlenbergbau gearbeitet haben oder deren Lebensumfeld vom Steinkohlenbergbau geprägt worden ist: der Kohlenhauer, der aus einer alten Bergarbeiterfamilie stammt, der Flüchtling oder Heimatvertriebene, der sich nach 1945 im Steinkohlenbergbau eine neue Existenz aufbaute, der türkische Migrant, der in den 1960er Jahren als „Gastarbeiter“ angeworben und bald zum Stammarbeiter wurde, die Mütter, Ehefrauen und Töchter aus Bergarbeiterfamilien, der Betriebsrat, der Gewerkschaftsfunktionär, der Zechendirektor, der Unternehmensmanager, der Beamte aus der staatlichen Bergbauaufsicht oder der frühverrentete „Bergbauinvalide“. Durch diese generationelle und funktionale Differenzierung ergibt sich ein facettenreiches Bild der komplexen Strukturen und Entwicklungen, denen der Steinkohlenbergbau von 1945 bis 2018 ausgesetzt war. Die individuellen Erinnerungen sind damit Bausteine zu einer Erfahrungs- und Wahrnehmungsgeschichte des Bergbaus der Jahrzehnte seit 1945, die zugleich eingebettet ist in die Geschichte des gesellschaftlichen Wandels in der Bundesrepublik allgemein.
Das Vorhaben versteht sich zunächst als wissenschaftliches Infrastrukturprojekt. Durch die geführten Videointerviews wird ein neuer Quellenkorpus geschaffen, der der Wissenschaft zukünftig zur Verfügung stehen soll. Alle Interviews werden transkribiert, inhaltlich erschlossen und nach archivfachlichen Gesichtspunkten dauerhaft gesichert. Neben dieser im engeren Sinne wissenschaftlichen Zielsetzung wird im Rahmen des Projekts eine Internetplattform erstellt, die die Ergebnisse der Befragungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Hier werden thematisch geordnet und ergänzt um weitere Materialien zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus nach 1945 Ausschnitte aus den lebensgeschichtlichen Interviews zu sehen sein.
Das Forschungsprojekt „Digitaler Gedächtnisspeicher: Menschen im Bergbau“ wird durch die RAG Aktiengesellschaft gefördert und soll bis zum Frühjahr 2018 abgeschlossen sein.
Kontakt:
Stefan Moitra
Jens Adamski
Hier geht es zur Website:
Menschen im Bergbau
Bergbaugeschichte hat viele Aspekte: Sie ist Teil der Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte, aber man kann sich ihr auch wissens-, geschlechter-, raum- oder umweltgeschichtlich nähern. Viele dieser Themen sind durch die historische Forschung eingehend untersucht worden. Welche Rolle spielt dabei aber die Erfahrungsperspektive der Beteiligten? Das Ende des aktiven Steinkohlenbergbaus in Deutschland im Jahr 2018 gibt Anlass, nach den Erinnerungen und Deutungen derjenigen zu fragen, deren Lebenswelt über Jahrzehnte von der Bergbauindustrie geprägt wurde. Vom Wiederaufbau nach 1945 bis zur allmählichen Schrumpfung ihrer Industrie waren die Bergleute einem vielfältigen Wandel unterworfen, sowohl mit Blick auf die Welt der Arbeitsverhältnisse unter Tage als auch in Hinsicht auf die Veränderungen der (übertägigen) Alltagskultur – sei es durch die Entfaltung neuer Jugendkulturen, veränderte Konsumpraktiken oder ganz allgemein durch einen Wandel des gesellschaftlichen Wertekanons.
Das Projekt „Menschen im Bergbau“ widmet sich den Erinnerungserzählungen früherer Bergleute und ihrer Angehörigen in den Steinkohlenregionen der alten Bundesrepublik. Ausgehend von den Ergebnissen des Vorgängerprojektes „Digitaler Gedächtnisspeicher – Menschen im Bergbau“, bei dem im Ruhrgebiet, im Saarland, im Aachener Revier sowie in Ibbenbüren knapp 90 lebensgeschichtliche Interviews geführt wurden, geht es nun darum, die gesammelten Quellen inhaltlich auszuwerten und in einen weiteren historiographischen Zusammenhang einzubetten. Im ersten Teilprojekt wird eine Monographie erarbeitet, die den Wandel des Steinkohlenbergbaus als Erfahrungs- und Erinnerungsgeschichte beschreiben wird. Das zweite Teilprojekt widmet sich der Rolle von Oral History und Konzepten von Zeitzeugenschaft im Kontext der Industriekultur. Zudem sollen, drittens, die Interviews didaktisch aufbereitet werden, so dass sie für den Schulunterricht und andere Bildungsangebote genutzt werden können. Dabei wird nicht zuletzt die Internetpräsenz des Projekts www.menschen-im-bergbau.de als digitale Plattform eine Rolle spielen.
Im Rahmen des Projektes kooperiert die Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets mit dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum sowie mit dem Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte der Ruhr-Universität.
Kein anderer Fluss steht so selbstverständlich für die historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Merkmale einer Region wie die Ruhr für das Ruhrgebiet. In den vergangenen Jahren ist sie zum Synonym für eine von Bergbau und Schwerindustrie geprägte Industriekultur und Kulturlandschaft geworden, die bei Menschen in ganz Deutschland – und darüber hinaus – sofort Assoziationen weckt: „Die Ruhr“ steht sinnbildlich für ein zentrales Stück deutscher Wirtschafts- und Gesellschafts- und Erinnerungsgeschichte – für Fördertürme und Fabrikschornsteine, aber auch für die De-Industrialisierung, den Strukturwandel und die damit einhergehenden sozialen Probleme.
Darüber ist die Ruhr selbst fast schon in Vergessenheit geraten: Das Gebiet, das sie durchfließt, wird in den Köpfen der Menschen heute kaum mehr mit dem Fluss verbunden, der ihm seinen Namen gab. Trotz aller Bemühungen um ‚Renaturierung’ und ‚Begrünung’ fehlt es heute noch an einer Rückbesinnung auf den Fluss als einen Ort der Identitäts- und Bewusstseinsbildung und damit auch als notwendiges Korrelat des wirtschaftsstrukturellen und gesellschaftlichen Wandels im Ruhrgebiet.
Hierzu möchte das Projekt einen Beitrag leisten. Es fügt sich somit ein in einen regionalen Kontext von Initiativen und Ansätzen, die die post-industrielle Identität des Ruhrgebiets schärfen und stärken wollen. Das Projekt möchte zwei Hauptaspekte in den Vordergrund rücken und in einem Zeitraum von etwa dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart verfolgen:
1. Der Fluss Ruhr, das Ruhrtal sowie die hier gelegenen Siedlungen und Städte sollen in Hinsicht auf ihre Identität und Heimat schaffende Qualität untersucht werden.
2. Die Ruhr soll in ihrer Beziehung zum Ruhrgebiet untersucht werden, und zwar einerseits im Hinblick auf die Funktion der Ruhr für das Ruhrgebiet und andererseits die Verortung des Flusses in der „mental map“ des Ballungsraums.
Das Projekt wird als Kooperationsprojekt zwischen der Brost-Stiftung und der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets durchgeführt.
Seit den Anfängen des Bergbaus war Deutschland eines der wichtigsten europäischen Bergbauländer. Seine Blütephasen erlebte der deutsche Bergbau vom Spätmittelalter bis weit in die Frühe Neuzeit auf der Grundlage von Salz- und Erzgewinnung sowie an der Wende zum 20. Jahrhundert, als Kohle und Stahl den Aufstieg Deutschlands zur Weltwirtschaftsmacht ermöglichten. Nirgendwo in Europa entfalteten sich ähnlich frühzeitig bergbauspezifische Kulturen und erlangten die Montanwissenschaften eine derartige Bedeutung. Wie keine andere wirtschaftliche Betätigung begründete der Bergbau Ruhm und Reichtum von Unternehmern, Fürsten, Volkswirtschaften und Nationalstaaten. Die „Epoche des Bergbaus“ dauert weltweit, auch in Deutschland, bis heute fort.
Die bergbauhistorische Forschung weist in Deutschland lange Traditionslinien auf und ist der Bedeutung ihres Gegenstandes entsprechend reichhaltig und hoch differenziert. Umso dringender ist der Bedarf an einer zusammenfassenden, handbuchartigen, repräsentativen Gesamtdarstellung, die den erreichten Stand des bergbaugeschichtlichen Wissens einer interessierten wissenschaftlichen und breiteren Öffentlichkeit leicht zugänglich macht.Geschichte des deutschen Bergbaus
Das vom Gesamtverband Steinkohlenbergbau finanzierte und von der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets durchgeführte Projekt betreibt die Publikation eines vierbändigen Handbuches, in dem ausgewiesene Experten die deutsche Bergbaugeschichte von den vor- und frühgeschichtlichen Anfängen bis zur Gegenwart in ihren jeweils politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhängen behandeln. Die Projektarbeiten werden von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet. Der erste, zweite, dritte und vierte Band sind inzwischen vollständig erschienen.
Die Steinkohle bildete die wichtigste Rohstoffgrundlage der deutschen Kriegswirtschaft zwischen 1939 und 1945. Zur Sicherung des riesigen Kohlenbedarfs der Rüstungswirtschaft, der Chemischen Industrie, der Energiewirtschaft, der Reichsbahn, der privaten Haushalte und zahlreicher anderer Verbraucher wurden seit 1940 Hunderttausende ausländischer Zivilarbeiter und Kriegsgefangener auf den Steinkohlenzechen beschäftigt, zunehmend unter Zwangsbedingungen. Der Steinkohlenbergbau entwickelte sich rasch zu einem der wichtigsten Einsatzfelder für Zwangsarbeiter in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft.
Vor dem Hintergrund der abschließenden Regelung von Entschädigungsleistungen für ehemalige Zwangsarbeiter um die Jahrtausendwende bat die RAG Aktiengesellschaft, eines der Gründungsmitglieder des Entschädigungsfonds der deutschen Wirtschaft, die Stiftung Geschichte des Ruhrgebietes, die besonderen Bedingungen des Zwangsarbeitereinsatzes im Steinkohlenbergbau wissenschaftlich umfassend klären zu lassen. Die Durchführung der Forschungsarbeiten, welche die RAG durch eine großzügige Zuwendung ermöglichte, wurde dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum übertragen. Die daraufhin gebildete Forschergruppe begann, unterstützt durch einen wissenschaftlichen Beirat und das Bergbau-Archiv Bochum, im September 2000 auf der Grundlage eines detaillierten Forschungsplanes mit der Arbeit. Das Forschungsprogramm sah nicht nur die gründliche Aufarbeitung der Zwangsarbeiterbeschäftigung in allen deutschen Steinkohlenrevieren vor, sondern beinhaltete auch die systematische Untersuchung des Arbeitseinsatzes in den vom Deutschen Reich besetzten Kohlenrevieren in Polen, Frankreich, Belgien, Holland, Jugoslawien und in der Sowjetunion. Darüber hinaus wurde noch der Zwangsarbeitereinsatz im Braunkohlenbergbau und im Steinkohlenbergbau während des Ersten Weltkrieges vergleichend miteinbezogen.
Bis zu 20 Wissenschaftler waren in kleineren oder größeren Einzelprojekten mit der Umsetzung des Forschungsprogramms bis zum Ende der Projektförderung im August 2005 beschäftigt. Zahlreiche Ergebnisse liegen inzwischen als wissenschaftliche Publikationen vor, beispielsweise das erste Heft des Jahrgangs 2005 von „Geschichte und Gesellschaft“ über „Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im besetzten Europa“. Die Hauptergebnisse des Projektes werden in einer eigenen Reihe des Instituts für soziale Bewegungen über „Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau“ publiziert, die auf zehn Bände angelegt ist. Bereits erschienen sind ein von Klaus Tenfelde und Hans-Christoph Seidel herausgegebener Sammelband mit Überblickscharakter, ein wissenschaftlich kommentierter Quellenband, eine Dissertation von Kai Rawe zum Zwangsarbeiterbeschäftigung im Ruhrbergbau während des Ersten Weltkrieges, eine weitere Dissertation von Thomas Urban zur mitteldeutschen Braunkohle im Zweiten Weltkrieg sowie ein Band, dessen Beiträge die Abschlusskonferenz des Projektes dokumentieren. Weiter vorgesehen sind ab dem Frühjahr 2007 Bücher über den Ruhrbergbau im Zweiten Weltkrieg, das nordfranzösische und belgische Kohlenrevier, das ukrainische Donez-Revier, den slowenischen und serbischen Bergbau sowie über den oberschlesischen Steinkohlenbergbau.